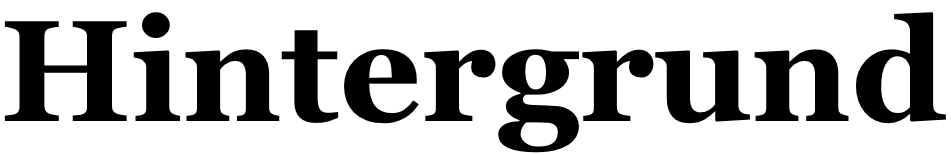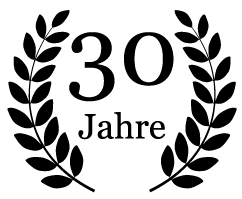Die Politik der aufgehaltenen Hand
Der Steuerstaat eignet sich — ähnlich einem Suchtkranken — immer größere Teile unseres Einkommens an. Ob libertäre Radikalkuren allerdings eine Lösung wären, bleibt fraglich.
Mächtige sagen nicht gern „Danke“ — sie wünschen, dafür gelobt zu werden, dass sie sich nicht noch mehr genommen haben. Der Staat hat Steuerzahlungen in seinem Sinne umgedeutet: von Geschenken, mit denen der Bürger seine Anteilnahme am Gemeinwesen zum Ausdruck bringt, hin zur Begleichung einer Schuld. Das macht psychologisch einen großen Unterschied. Schenkende behandelt man mit Respekt und Dankbarkeit, versucht, sich mit ihnen gut zu stellen, sucht nach Wegen, ihnen auch einmal etwas zurückzugeben. Schuldner dagegen treibt man an, man verachtet sie („Steuersünder“), man zerrt an ihnen. Der Gläubiger betrachtet ihre Zahlungen als Selbstverständlichkeit, bedroht sie jedoch im Fall von „Säumnis“. Die Schuld wird in Deutschland als so groß gedacht, dass nur lebenslange Ratenzahlungen im Umfang von rund der Hälfte dessen, was man verdient, diese einigermaßen begleichen können, wie Peter Sloterdijk scharfsinnig anmerkt. Versäumte oder verspätet gemachte Geschenke vermehren die bisher gemachten Schulden, vergrößern also die Pflicht zu weiterem finanziellem Aderlass zugunsten des Fiskus. Das Finanzamt agiert ohne Respekt, im günstigsten Fall nimmt es die Gaben in einer Haltung lethargischer und selbstgerechter Routine entgegen. Auf der anderen Seite ist beim Staat kein Bemühen erkennbar, dem Bürger für erhebliche, bezahlte Summen, deren Verlust viele Bürger durchaus schmerzt, eine adäquate Gegenleistung zu bringen. Der Artikel beschäftigt sich mit den Nötigungsroutinen des Steuerstaats, stellt aber auch die Frage, ob libertäre Träume von einer Null-Steuer-Gesellschaft wirklich zu mehr Gerechtigkeit führen würden. Vielleicht wäre es mit der legalen Ausplünderung der Arbeitenden dann nicht vorbei — sie wären lediglich mit anderen Plünderern konfrontiert.
Die Politik der aufgehaltenen Hand