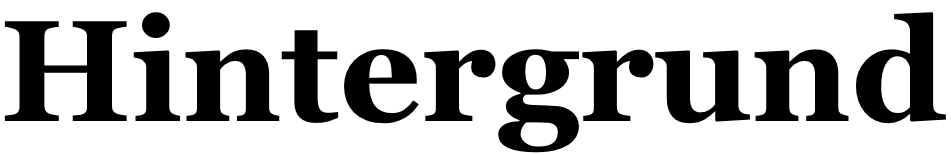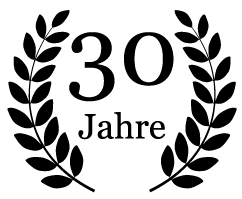Beschäftigte im Gesundheitswesen protestieren gegen „Kriegsmedizin“
„Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs“ kritisieren Triage im Kriegsfall: Soldaten hätten Vorrang vor Zivilisten / Andere Ärzteverbände unterstützen Vorbereitungen auf militärischen Konflikt / Charité lädt Bundeswehr-Oberst nach Ärzteprotesten wieder aus
(Diese Meldung ist eine Übernahme von Multipolar)
Friedensorientierte Ärzteorganisationen wehren sich gegen die Militarisierung des deutschen Gesundheitswesens. Eine im September gestartete Kampagne der „Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs“ (IPPNW) wurde inzwischen knapp 900 mal unterzeichnet. Konkret heißt es in der Kampagne: „Ich lehne als Beschäftigte/Beschäftigter im Gesundheitswesen jede Schulung oder Fortbildung in Kriegsmedizin ab und werde mich daran nicht aktiv beteiligen.“ Weiterhin widersprechen Unterzeichner „jeder Maßnahme“, die „Kriegsmedizin“ Vorrang vor ziviler medizinischer Versorgung gibt.
Kritisiert wird von den Organisationen unter anderem die „umgekehrte Triage“, die im Kriegsfall eintreten würde. Hierbei habe militärisches Personal Vorrang bei der medizinischen Behandlung gegenüber Zivilisten, da es oberstes Ziel sei, Soldaten schnell wieder einsetzbar zu machen. Dies gelte selbst dann, wenn betroffene Soldaten nur leicht verletzt, die Zivilisten jedoch schwer verletzt wären. Die „Erklärung für ein ziviles Gesundheitswesen“ spricht sich ausdrücklich gegen Triage im Krieg aus. Diese orientiere sich an der Aufrechterhaltung der „Kriegsfähigkeit“, heißt es in der IPPNW-Erklärung.
Für IPPNW-Mitglied Bernd Hontschik, Chirurg aus Frankfurt am Main, ist jede Triage heikel. Sie zwinge in tragische Situationen, in denen es kein Richtig und kein Falsch mehr geben könne, erklärte er auf Anfrage von Multipolar. Eine „umgekehrte Triage“ sei der Gipfel des „Missbrauchs“ medizinischer Kompetenz. „Leicht verletzte Militärs bei der Behandlung schwer verletzten Zivilisten vorzuziehen, ist schlicht und einfach eine völlige Perversion ärztlichen Denkens und Handelns“.
Bei einem bundesweiten „Warntag“ Anfang September wies die IPPNW auf im Jahr 2024 beschlossene Änderungen in den „Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung“ hin. „In der alten Fassung war von Kriegsverhütung die Rede. Daraus wurde so etwas wie Kriegsertüchtigung“, erklärte Angelika Claußen, Präsidentin von IPPNW Europa. Unter Verweis auf die aktuelle Ausarbeitung eines „Gesundheitssicherstellungsgesetzes“ und damit zusammenhängenden Triage-Plänen warnte sie zudem, es werde bei der Krankenversorgung zu „deutlichen Einschränkungen“ kommen.
Andere Ärzte unterstützen hingegen die Vorbereitungen im Gesundheitswesen auf einen militärischen Konflikt. Der Wolfsburger Chefarzt Tomislav Stojanoviv, der im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin tätig ist, forderte in einem Interview (15. November) mit der Zeitung „Tagesspiegel“, dass sich deutsche Kliniken und die Ärzteschaft auf den Kriegsfall vorbereiten müssten. Die Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland haben in der vergangenen Woche zum Thema „Sicherstellung der ambulanten Versorgung im Krisenfall“ getagt.
Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) bot ihren Mitgliedern im September in Ulm einen Kurs zum Thema „Terror and Disaster Surgical Care“ (TDSC) an, um sich auf einen „befürchteten“ Angriff Russlands auf einen der baltischen Staaten oder Polen vorzubereiten. Laut DGOU-Generalsekretär Dietmar Pennig benötigt Deutschland 3.000 Ärzte, die Kriegsverletzungen behandeln können. Davon sei man weit entfernt. Insgesamt wären 480 Millionen Euro notwendig, um das zivile Gesundheitssystem Deutschlands „wehrhaft“ zu machen.
Auf der vierten Gemeinschaftstagung der zahnmedizinischen Fachgesellschaften Ende Oktober in Berlin forderte der Oberstarzt Richard Werkmeister vom Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz: „Die chirurgische Ausbildung von Zahnärzten und Ärzten in Deutschland muss gestärkt werden, um eine effektive Versorgung bei schweren Verletzungen, sei es durch Krieg, Terror oder andere Katastrophen, sicherzustellen.“ Zivile Krankenhäuser und Rettungssysteme seien gefordert, sich auf Katastrophenszenarien vorzubereiten. Um Erfahrungen weiterzugeben, würden Ärzte aus Krisengebieten, etwa aus der Ukraine, zu deutschen Kongressen eingeladen. „Ukrainische Kollegen haben während des Krieges viel gelernt und leisten hervorragende Arbeit, oft mit internationaler Materialunterstützung“, berichtete der Professor.
Im Virchow-Klinikum der Berliner Charité fand im November ein dreitägiges Symposium „Zivile Notfall- und Rettungsmedizin. Bevölkerungsschutz“ statt, gegen das Ärzteorganisationen demonstrierten. Die Veranstaltung stehe beispielhaft für die „Militarisierung des Gesundheitswesens“ heißt es in einer Pressemitteilung des Protestbündnisses. Wegen der Kritik sei ein Oberst der Bundeswehr, der über den „Operationsplan Deutschland“ sprechen sollte, von der Charité wieder ausgeladen worden.