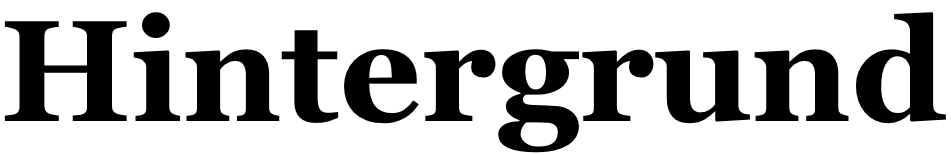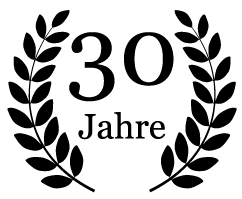Britisches Magazin sieht Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr
„The Economist“ berichtet über Gerichtsurteil, Hausdurchsuchung und Vorhaben der Bundesregierung / Kritik an besonderer Behandlung der Politiker im Strafgesetzbuch – Juristen fordern Abschaffung des Paragraphen für „Majestätsbeleidigung“ / Künftige Koalition will Vorgehen noch verschärfen
(Diese Meldung ist eine Übernahme von Multipolar)
Das britische Magazin „The Economist“ hat einen kritischen Artikel zur Meinungsfreiheit in Deutschland veröffentlicht. Darin wird insbesondere die juristische Verfolgung der Kritik an Politikern thematisiert. Als Beispiele nennt „The Economist“ den Fall des Chefredakteurs des Deutschland-Kuriers, der für ein bearbeitetes satirisches Foto zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Zusätzlich wurde ihm eine Geldstrafe auferlegt, und er muss sich bei der abgebildeten Innenministerin Nancy Faeser (SPD) entschuldigen. Sie hielt in dem bearbeiteten Bild den Satz „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ in die Kamera, im Original stand in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz „#WeRemember“. Als zweites Beispiel wird im Artikel die Hausdurchsuchung bei einem Rentner in Bayern angeführt, der Robert Habeck (Grüne) als „Schwachkopf“ bezeichnete.
Der „Focus“ hat den Artikel ins Deutsche übersetzt. Laut „The Economist“ zeugen Faesers juristische Schritte gegen das bearbeitete Bild davon, dass der verantwortliche Journalist mit seiner Kritik richtig liege. „Viele Beobachter in einem Land, dessen Verfassung die freie Meinungsäußerung und -verbreitung, ausdrücklich auch von Bildern, garantiert, waren schockiert“, heißt es. Dabei verweist das Magazin darauf, dass der Bundestag 2021 aus Sorge um die Verbreitung von Beleidigungen und Fehlinformationen den Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs verschärft hat. Dieser Paragraf behandelt Beleidigungen, die gegen Personen des politischen Lebens gerichtet sind. Sind diese geeignet, „das öffentliche Wirken erheblich zu erschweren“, kann eine „üble Nachrede“ mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren und eine „Verleumdung“ mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.
Der Paragraf 188 wird von Kritikern wie dem Rechtsprofessor Josef Franz Lindner mit der „Majestätsbeleidigung“ früherer Zeiten verglichen. Auch der Rechtsexperte des Spiegels, Dietmar Hipp, forderte in der vergangenen Woche mit Blick auf die vom „Economist“ zitierten Fälle die ersatzlose Streichung des Paragrafen 188 des Strafgesetzbuches. Dieser sei zum „Bumerang für den Rechtsstaat“ geworden. Fiele der Paragraf weg, würden üble Nachrede, Beleidigung und Verleumdung weiterhin bestraft, wenn auch tendenziell milder.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wird allerdings ein anderer Weg beschritten. „The Economist“ berichtet, dass es künftig möglich sein soll, „gegen die ,vorsätzliche Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen‘ vorzugehen“. Das Magazin geht zudem auf eine Allensbach-Umfrage ein, nach der Ende 2023 nur noch etwa 40 Prozent der Deutschen davon ausgingen, ihre Meinung frei aussprechen zu können. 1990 war der Wert noch etwa doppelt so hoch. In Deutschland sei dabei nicht nur die oppositionelle Rechte, sondern auch die radikale Linke betroffen, „The Economist“ verweist insbesondere auf pro-palästinensische Konferenzen und Demonstrationen, die von der Polizei aufgelöst wurden.
Der Artikel des britischen Magazins wurde auch von weiteren Medien aufgegriffen. In Deutschland wurde er erstmalig am Ostermontag vom Internet-Portal „Apollo News“ zitiert. Die „Berliner Zeitung“ verwies auf die internationale Aufmerksamkeit, die das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland beispielsweise durch Elon Musk auf „X“ erhalte. Auch die „Welt“ und die Schweizer „Weltwoche“ berichteten über den Artikel. „Tichys Einblick“ betonte, „The Economist“ sei „alles andere als ein rechtspopulistisches“ Magazin, „sondern eines der renommiertesten Wirtschaftsmagazine der westlichen Welt.“
Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel forderte: „Der ,Majestätsbeleidigungsparagraph‘ muss weg!“ Zensurgesetze und Willkürurteile ruinierten Deutschlands Ruf. Der ehemalige Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) schrieb unter Bezug auf den Artikel auf „X“: „Die Bundesrepublik ist durch Freiheit zum Erfolgsmodell geworden – nicht durch Repression.“