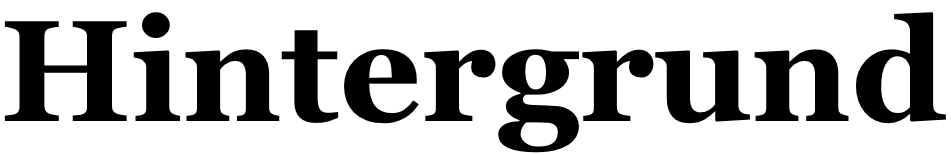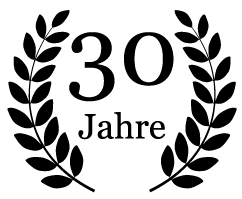EU-Sanktionen gegen deutschen Journalisten wegen Berichterstattung über Proteste in Deutschland
Russland-kritischer Journalist unterliegt Kontosperrung, Berufsverbot, Reiseverbot / EU: Berichterstattung zu pro-palästinensischen Protesten in Deutschland nutzt Russland / Kritiker befürchten Kriminalisierung unerwünschter Berichterstattung
(Diese Meldung ist eine Übernahme von Multipolar)
Neben den Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper listet die Europäische Union (EU) in ihrem letzten Sanktionspaket gegen Russland (20. Mai) auch das Onlinemedium „red.“ und dessen Gründer und Chefredakteur Hüseyin Dogru. Multipolar schildert den Fall in einem aktuellen Beitrag ausführlich. Im Gegensatz zu Lipp und Röper lebt Dogru mit seiner Frau und seinem Kind in Deutschland. Seine Frau ist zudem im siebten Monat schwanger. Die EU-Sanktionierung bedrohe Dogru und seine Familie existenziell. Konten seien gesperrt, die Deutsche Bundesbank gewähre auf Antrag lediglich „Gelder zur Befriedigung von Grundbedürfnissen“. Dogru dürfe nicht arbeiten und auch das Land nicht verlassen. Auf „X“ schreibt er: „Ich wurde nicht angeklagt. Ich stand nicht vor Gericht. Ich wurde keiner Straftat für schuldig befunden. Ich hatte keine Möglichkeit, mich zu verteidigen“.
Die EU begründet die Sanktionierung von „red.“ und Dogru mit der Berichterstattung zu pro-palästinensischen Protesten angesichts des Kriegs in Gaza. Die EU kommt zur grundsätzlichen Einschätzung, „red.“ habe „systematisch falsche Informationen über politisch kontroverse Themen“ verbreitet. Es habe absichtlich „unter seinem überwiegend deutschen Zielpublikum ethnische, politische und religiöse Zwietracht“ säen wollen, „unter anderem durch die Verbreitung der Narrative über radikalislamische terroristische Gruppierungen wie die Hamas“. Die EU schlussfolgert daraus, Dogru unterstütze „Handlungen der Regierung der Russischen Föderation, die die Stabilität und Sicherheit in der Union und in einem oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten untergraben und bedrohen“. Ferner soll „red.“ beziehungsweise das in Istanbul ansässige Medienunternehmen „AFA Medya A.S.“, das das Projekt betreibt, finanziell und organisatorisch mit Russland verbunden sein.
Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes bekräftigte gegenüber Multipolar die Vorwürfe. Auf der Bundespressekonferenz am 2. Juli erklärte ein Sprecher zudem, Grundlage des „nationalen Attribuierungsverfahrens“ sei „eine umfassende Analyse der deutschen Sicherheitsbehörden“. Weitere Details zur Beweisführung wurden auch auf Nachfrage nicht genannt. Die Sprecherin der EU-Kommission für Außen- und Sicherheitspolitik, Anitta Hipper, erklärte auf Multipolar-Anfrage die Entscheidungen des Rates „beruhen auf Rechtsstaatlichkeit“. Die betroffene Person habe das Recht, beim Rat Einspruch zu erheben und eine Streichung zu beantragen. Sie könne außerdem Rechtsmittel einlegen und die Aufnahme in die Sanktionsliste vor europäischen Gerichten anfechten. Der Inhalt dieser gerichtlichen Auseinandersetzungen sei jedoch „vertraulich“.
Multipolar fragte die im Bundestag vertretenen Oppositionsparteien AfD, Grüne und Linke sowie zusätzlich FDP und BSW, ob sie von weiteren Beweisen wüssten. Lediglich Sevim Dagdelen vom BSW antwortete. Ihr liegen keine Beweise vor. Auch über die angebliche russische Finanzierung des Mediums gebe es aus ihrer Sicht „keine verifizierbaren Quellen“. Die entsprechende Einstufung scheine allein aufgrund von „Geheimdienstinformationen“ zustande gekommen zu sein. Es sei „nicht nachprüfbar, wie verlässlich diese Informationen sind“, sagte Dagdelen. Laut einem Bericht der Zeitung „Junge Welt“ hätten Dogru und seine Anwälte inzwischen Akteneinsicht erhalten. Dort seien „keine geheimen Beweise“ zu finden. In einer Stellungnahme von „red.“ auf „Telegram“ Anfang Juli heißt es, die Akten enthielten „kein einziges Wort über Verbindungen nach Russland“.
Multipolar rekonstruiert in seinem Bericht, dass die Anschuldigungen maßgeblich auf Berichte des „Tagesspiegel“ zurückgehen. So berichtete die Zeitung im Juni 2024, sie habe erfahren, dass „deutsche Sicherheitskreise“ davon ausgingen, „red.“ sei ein „Nachfolger“ der staatlich russischen Videoplattform „Redfish“. Der Bericht wurde wenige Monate später in einer Pressemitteilung vom US-Außenministerium aufgegriffen. Ein Tag später titelte wiederum der „Tagesspiegel“: „Moskaus ‚verdeckte Einflussnahme‘ in Deutschland: USA sehen Medium ‚Red‘ als Werkzeug des Kremls“.
„Red.“ selbst bestreitet die Vorwürfe. Auf der Webseite heißt es, es gebe zwar personelle Überschneidungen zwischen Mitarbeitern von „red.“ und ehemaligen „Redfish“-Mitarbeitern. Allerdings handele es sich bei den beiden Plattformen um „zwei verschiedene Unternehmen“. „Red.“ sei ein „unabhängiges Unternehmen“. Zur Finanzierung macht „red.“ selbst keine näheren Angaben. Das Medium erhalte „Spenden von Organisationen und Einzelpersonen“. Der Vorwurf, „red.“ sei eine „Fortsetzung des Projekts redfish oder ein russisches Desinformationsmedium“ sei „unbelegt“ und „gezielt konstruiert“.
Zudem betont das Medium auf seiner Webseite, seine Haltung gegenüber Russland sei „klar dokumentiert“: Russland sei „wie die USA, China, die EU oder die NATO“ „eine imperialistische Macht“, die ihre eigenen geopolitischen Interessen verfolge. „Red.“ lehne „jede Form militärischer Aggression“ ab: „Wir haben den Überfall auf die Ukraine öffentlich kritisiert, über die Repression gegen Oppositionelle in Russland berichtet und stets betont, dass es sich um einen Krieg zwischen zwei imperialistischen Blöcken handelt“.
Multipolar wollte von der Bundesregierung und der EU-Kommission wissen, wie bei „politisch kontroversen Themen“ „richtige“ von „falschen Informationen abzugrenzen seien“. Die Frage blieb unbeantwortet. Auch AfD, Grüne, Linke und FDP äußerten sich nicht. Ebenso wenig reagierten angefragte Pressevertreter wie „Reporter ohne Grenzen“ oder der „Deutsche Journalistenverband“ auf Anfragen. Sevim Dagdelen wertete die Vorgehensweise von Bundesregierung und EU gegenüber Multipolar als „Angriff auf die Pressefreiheit“ und „Versuch einer regierungsamtlichen Wahrheitsproduktion“. Die „Nachdenkseiten“ wiesen darauf hin, dass mit der Argumentation, die Berichterstattung über „nicht genehme Proteste“ unterstütze „indirekt Handlungen der Regierung der Russischen Föderation“, „sich ab jetzt bei Bedarf jede Art von kritischer Berichterstattung sanktionieren und kriminalisieren“ ließe.