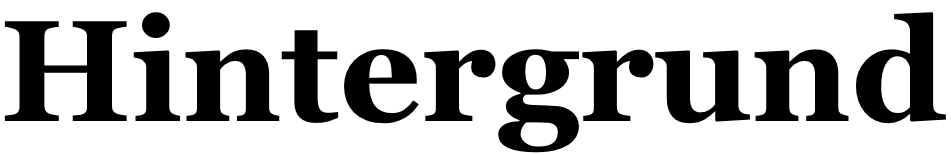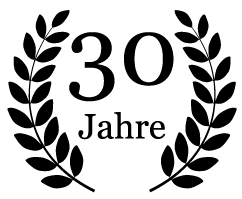Führender Journalist der Süddeutschen Zeitung wird Regierungssprecher
Stefan Kornelius langjähriger Ressortleiter bei SZ und Mitglied der „Atlantik-Brücke“ / Kritik an „Drehtür“ zwischen etablierten Medien und Bundesregierung / Journalismus-Professor: Verbindung zu den Leitmedien könnte Kanzler Merz helfen
(Diese Meldung ist eine Übernahme von Multipolar)
Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Politik-Chef der Süddeutschen Zeitung (SZ) Stefan Kornelius zum neuen Regierungssprecher berufen. Kornelius war zuvor bis 2021 Leiter des Ressorts Außenpolitik bei der SZ und arbeitete seit 1991 bei der Tageszeitung aus München. Einer größeren Öffentlichkeit wurde er 2014 durch eine Folge der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ bekannt, die die Vernetzung deutscher Außenpolitik-Journalisten mit transatlantischen Organisationen thematisierte. Kornelius ist unter anderem Mitglied bei der US-nahen Lobbyorganisation „Atlantik-Brücke“.
Oppositionsparteien und Teile der Medienlandschaft äußerten Kritik an der Personalie. Martin E. Renner, medienpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, erklärte, die Berufung von Kornelius sei ein „weiterer Beweis für die unstatthafte Nähe von Politik und Journalismus“. Fabio de Masi (BSW) schrieb: „Viele unserer Meinungsmacher in der aktuellen Medienlandschaft sind bereits Regierungssprecher. Die arbeiten nur im Außendienst.“ Die Zeitung „taz“ erläuterte, Kornelius sei die „perfekte Besetzung“ für das Amt des Regierungssprechers, denn dieser müsse die Linie der Bundesregierung vertreten und sich mit „Propaganda“ auskennen.
Der Medienkritiker Marcus Klöckner erinnert daran, dass Kornelius den „Wikileaks“-Gründer Julian Assange als „Gefährder“ bezeichnete und in der Corona-Krise als Befürworter einer Impfpflicht auftrat. Kornelius’ positioniere sich bei politischen Themen regelmäßig sehr nah an der erwünschten Linie der etablierten Politik. In der Berliner Zeitung heißt es man könne den Eindruck gewinnen, Journalisten seien käuflich. Kornelius führe eine Tradition fort, „die seit Jahr und Tag falsch ist“. Schließlich seien auch seine Vorgänger im Amt des Regierungssprechers Journalisten gewesen.
Der noch amtierende Regierungssprecher Steffen Hebestreit arbeitete bei der Frankfurter Rundschau, dessen Vorgänger Steffen Seibert war vor seinem Amtsantritt Nachrichtenmoderator im ZDF. Im Sprecher-Team der noch amtierenden Regierung von Olaf Scholz (SPD) befinden sich noch weitere hochrangige Ex-Journalisten. So arbeitet die Stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann vorher für den „Spiegel“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). Ihr Kollege Wolfgang Büchner war zuvor Chefredakteur der Deutschen Presseagentur (dpa) und beim „Spiegel“. Besonders bedenklich ist es laut „Berliner Zeitung“, wenn Journalisten einen zweifachen Wechsel hinlegten wie Ulrich Wilhelm, der Journalist, Regierungssprecher und später Intendant des Bayerischen Rundfunks war. Auch Ulrike Demmer, heute Intendantin des RBB, war zunächst Journalistin und dann stellvertretende Regierungssprecherin.
Diese Rückkehr von der PR zurück in die Redaktionen insbesondere im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk kritisiert auch der emeritierte Journalismus-Professor Stephan Russ-Mohl gegenüber Multipolar. Den Seitenwechsel von Journalisten an sich sieht er weniger problematisch. Er glaube nicht, dass das Vertrauen in Medien und Journalismus beschädigt wird. Kornelius könne mit seinen Kontakten zu einzelnen Redaktionen von Leitmedien helfen, das Bild zu beeinflussen, das diese Medien im Ausland von Merz und seiner Regierung zeichnen. Außerdem könnte die Außenpolitik-Expertise von Kornelius dem neuen Bundeskanzler dabei helfen, international Profil zu gewinnen und die Führungsrolle Deutschlands in Europa auszubauen, sagte Russ-Mohl. Kornelius sei ein „hochangesehener Journalist“ – dies werde „lagerübergreifend“ so beurteilt. „Gute Journalisten sind allerdings nicht automatisch auch gute Regierungssprecher, sprich: PR-Leute.“
Regierungssprecher Hebestreit sagte auf den Wechsel zwischen Medien und Regierung angesprochen: „Man ist ein Bindeglied zwischen Journalismus und Politik.“ Als Regierungssprecher sei es von Vorteil sowohl die Politik als auch den Journalismus zu kennen. Es sei nützlich zu wissen, „wie der Journalismus funktioniert, welche Gesetzmäßigkeiten es gibt, worauf man achten muss“. Das Online-Magazin „Nachdenkseiten“ wies darauf hin, dass viele der vergangenen Pressesprecher der Bundesregierung einen „längeren Auslandsaufenthalt in Washington D.C.“ absolviert haben. Neben Hebestreit und Wilhelm zähle dazu auch Kornelius.
Kornelius’ Verflechtung mit transatlantischen Netzwerken hat der Leipziger Journalismus-Forscher Uwe Krüger in seinem Buch „Meinungsmacht“ (2013) beschrieben. In einem Interview erklärte er 2015, Kornelius habe regelmäßig an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen, sei unter anderem Mitglied in der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik“, saß im Präsidium der „Deutschen Atlantischen Gesellschaft“, die Lobbyarbeit für die Nato betreibe, nahm an vielen Veranstaltungen des „American Institute for Contemporary German Studies“ teil und saß im Beirat der „Bundesakademie für Sicherheitspolitik“, einer Organisation des Verteidigungsministeriums. Solch „eine Beratertätigkeit aber beißt sich mit der journalistischen Aufgabe, gegenüber der Bundesregierung eine Kontrollfunktion auszuüben“, kritisierte Krüger.
Kornelius selbst reagierte damals auf die Kritik mit der Aussage, dass jeder politische Journalist so nahe wie möglich am Gegenstand seiner Berichterstattung sein sollte, ohne seine Unabhängigkeit zu riskieren. „Wir wollen doch wissen, wie die Entscheider ticken, warum sie etwas machen, wer sie berät, welchen Zwängen sie gehorchen. Das ist pure journalistische Neugier. Aber Nähe bedeutet doch nicht Verbrüderung.“ Kornelius sagte, er selbst meide „jede aktive Rolle in einem Theater, über das ich möglicherweise selbst einmal eine Kritik schreiben muss“.