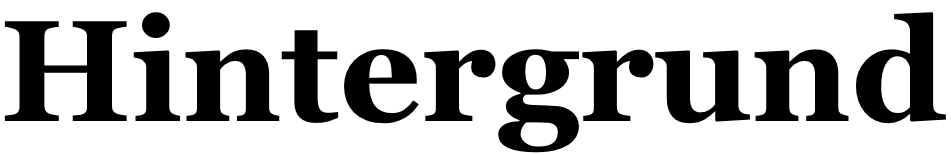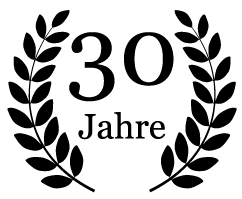Die kastrierte Öffentlichkeit
Über Cancel Culture, die Unterwerfung der Universitäten und dressierten Nachwuchs
 Foto: hosnysalah; Quelle: pixabay; Lizenz
Foto: hosnysalah; Quelle: pixabay; LizenzDie Überschrift ist ein Versuch, meine letzten drei Bücher auf einen Nenner zu bringen – angeregt von Ronald Thoden, Herausgeber dieser Zeitschrift und zugleich Kurator einer Ausstellung im Berliner Sprechsaal, die Bilder aus Gaza zeigt. Etwas mehr als 30 Pressefotos, geliefert von der Nachrichtenagentur dpa. Erschütternd. Das passt doch perfekt zu dem, was du gerade machst, lieber Michael, sagte Thoden und bat mich, kurz vor der Eröffnung Cancel Culture, die Unterwerfung der Universitäten und den „dressierten Nachwuchs“ in einem Vortrag zu verbinden.
Der Anlass lag auf der Hand. Francesca Albanese natürlich, Völkerrechtlerin von Format und UN-Sonderberichterstatterin für Palästina, aber in deutschen Hochschulen unerwünscht, zumindest an der LMU in München und an der Freien Universität in Berlin, wo im Februar Albanese-Auftritte geplatzt waren, hier unterfüttert mit dem Grundsatz, dass die LMU generell „keine Räumlichkeiten für allgemein-politische Veranstaltungen zur Verfügung“ stelle, und dort mit einer „nicht kalkulierbaren Sicherheitslage“. In Bayern kam Zuspruch von Ludwig Spaenle, Antisemitismus-Beauftragter der Landesregierung.
Die „Münchner Rede“ von Andreas Zumach
Ich vermute: Das hat mich getriggert. Ich kenne das Stück, aufgeführt mit den gleichen Schauspielern im Herbst 2018, als ich Andreas Zumach in den Hörsaal nach München eingeladen hatte, damit er über „Israel, Palästina und die Grenzen des Sag- baren“ sprechen kann. Nach der Ankündigung hat es keine Stunde gedauert, bis das Störfeuer losging. Spaenle und seine Leute hatten Schützenhilfe bis ganz nach oben und von was weiß ich nicht noch woher. Jerusalem Post. Wir haben das durchgezogen, einen denkwürdigen Abend erlebt und manches davon bis in den Gerichtssaal tragen müssen. Das Video ist noch im Netz. Fahnen, reinrufen, Türen schlagen. Draußen junge Leute, die jeden warnen, der zuhören will. Achtung, Verschwörungstheoretiker! Querfrontaktivisten! Passt auf!
Gesprochen hat Andreas Zumach über die Hasbara, eine Propaganda-Kampagne der israelischen Regierung, gestartet nach dem Jom-Kippur-Krieg und Ende 2024 wieder ein Thema, als The Forward meldete, das Außenministerium bekomme dafür jetzt 150 Millionen Dollar und damit das Zwanzigfache des bisherigen Budgets. Wir müssen nicht über Zahlen streiten. Es ist selbst in Deutschland nicht einfach, alle PR-Etats der aktuellen Koalition zu überblicken. Für Israel nannte Zumach schon 2018 „eine dreistellige Millionen-Dollar-Dimension“.
Wer Videos nicht mag: Auch der Text ist im Netz. Man kann dort nachlesen, worum es bei der „Soft-Power-Diplomatie“ geht. Aus Sicht der Regierung in Jerusalem: die öffentliche Meinung in den USA für sich gewinnen und damit das Weiße Haus. Gleich danach kommt England und dann schon Deutschland. Man kann bei Andreas Zumach auch lernen, welche Wucht die Hasbara entfaltet und wie viele Helfer die Kampagne hierzulande hat. Er nennt Ross und Reiter, unterfüttert mit Quellen. Und er sagt auch, dass die Maschine inzwischen so gut geölt sei, dass sie für das Warmlaufen nur 30 Sekunden brauche. Eine halbe Minute, nicht länger, bis auf den Plattformen alle verleumdet und unter Druck gesetzt werden, die an einer US-Universität etwas zu Palästina oder BDS ankündigen, zu den „drei fürchterlichen Buchstaben“ (Zumach), die für „Boycott, Divestment and Sanctions“ stehen, eine Bewegung, die Benjamin Netanjahu schon 2015 in den Rang einer „existenziellen Bedrohung“ erhob, zu bekämpfen von Geheimdienstleuten. Auch hier will ich nicht über Zahlen streiten. Wichtig ist: Die Netzarmee war schon vor sieben Jahren riesig und technisch auf der Höhe der Zeit. Und nach dem 7. Oktober 2023 wurde wieder kräftig nachgerüstet. Vielleicht noch mehr als in jedem anderen Krieg geht es im Nahen Osten um die Köpfe.
Potenz von Öffentlichkeit
So eine Ausstellung im Sprechsaal kämpft da natürlich mit. Früher hätte ich gesagt: wer weiß. Vielleicht schwappt das ja von der Marienstraße in Berlin ins Kanzleramt. So weit ist das schließlich nicht. Ich hätte dabei die Theorie auf meiner Seite gehabt. Öffentlichkeit, so hieß es dort, ist der Ort, an dem sich Bürger und Politik treffen. Hier können die einen sagen, welche Probleme sie haben, und die anderen schlagen vor, wie man das angehen könnte – und werden darin entweder bestärkt oder zurückgepfiffen. Dieses Abwägen, so weiter in der Theorie, beginnt in der Kneipe, in der Bahn oder auf dem Fußballplatz – überall da, wo wir Menschen treffen und spüren können, ob wir völlig danebenliegen oder rausgehen können aus dem Schneckenhaus, in den Sprechsaal zum Beispiel mit Gaza-Bildern, zu den Vorträgen, die ich halte, in Zeitschriften wie Hintergrund oder zu einer Demonstration und damit irgendwann auch in die Leitmedien, die den Bürgerwillen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ignorieren können und so für alle sichtbar machen, auch und vor allem für die Entscheider in der Regierung.
Diese Theorie ist von 1990, geschrieben auch unter dem Eindruck des Umbruchs in Osteuropa. Im Arena-Modell der Öffentlichkeit können wir getrost auf der Tribüne bleiben und uns anschauen, was die Spieler da unten so treiben. Wenn es uns doch einmal zu bunt werden sollte, suchen wir einfach ein paar Gleichgesinnte, fangen an zu lärmen und werden irgendwann schon gehört werden auf dem Rasen. Ich vereinfache das ein wenig, um herausarbeiten zu können, was Öffentlichkeit für eine Gesellschaft leisten kann. Bei mehr als 80 Millionen Menschen wird man selbst dann nicht immer die Mehrheit für sich gewinnen, wenn man lauter krakeelt als alle anderen. Das Gefühl aber, gesehen und vor allem nicht ohne jedes Argument an den Rand geschoben worden zu sein, sichert den inneren Frieden und motiviert dazu, sich bei der nächsten Streitfrage wieder einzubringen in das große Gewimmel.
Den vollständigen Text lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 7/8 2025 unseres Magazins, das im Bahnhofsbuchhandel, im gut sortierten Zeitungschriftenhandel und in ausgewählten Lebensmittelgeschäften erhältlich ist. Sie können das Heft auch auf dieser Website (Abo oder Einzelheft) bestellen.
MICHAEL MEYEN ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der LMU München. Veröffentlichungen: Wie ich meine Uni verlor (2023), Cancel Culture (2024) und Der dressierte Nachwuchs (2024). Videos: https://www.youtube.com/@Michael_Meyen