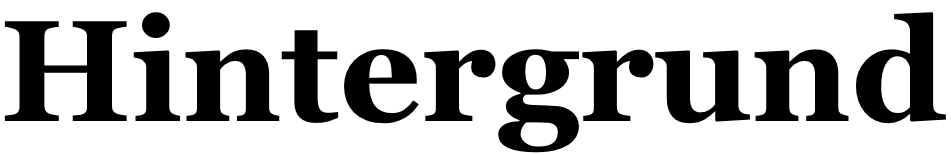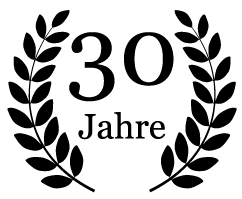Wird die Weltfinanzkrise zu einer Gefahr für Wohlstand und Demokratie?
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von CHRISTOPH BUTTERWEGGE, 4. März 2009 –
Die globale Finanzkrise, deren Auswirkungen weder bereits alle sichtbar noch erst recht bewältigt sind, berührt und erschüttert alle Lebensbereiche: Bankwesen, Wirtschaft und Beschäftigung, aber auch Staat, Politik und Kultur, wenn nicht gar die Demokratie. Man muss die Finanzkrise in einen größeren Zusammenhang stellen, ist sie doch nicht nur eine Folge der zu freigiebigen Kreditvergabe amerikanischer Hypothekenbanken, sondern auch die zwangsläufige Konsequenz eines nach neoliberalen Vorstellungen umgestalteten Banken-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Es handelt sich dabei um jenen „Kasinokapitalismus“ (Susan Strange), vor dessen Anfängen schon der britische Ökonom John Maynard Keynes gewarnt hat. Statt auf industrieller Wertschöpfung beruht dieses System auf hoch spekulativen Geldanlagen mittels immer komplexerer Produkte (Derivate/Zertifikate), die unvorstellbaren Reichtum bei wenigen Finanzmagnaten und immer mehr Armut nicht nur in der sog. Dritten Welt, sondern auch in den Konsumgesellschaften des Nordens entstehen lassen. Das neoliberale Projekt verschärft die sozialen Ungleichheiten in bislang nicht bekannter Form, verspricht Arbeitnehmer(inne)n, prekär Beschäftigten und Erwerbslosen jedoch immer noch mehr Wohlstand, dauerhaftes Wirtschaftswachstum und den Abbau der Massenarbeitslosigkeit – ganz so, als wären nicht jedem Konjunkturaufschwung schon bald die Rezession und häufig genug auch ein Börsenkrach gefolgt.
Je stärker Hedgefonds, Private-Equity-Firmen und transnationale Konzerne das Wirtschaftsgeschehen auf dem ganzen Planeten beherrschten, ohne dass ihnen durch öffentliche Institutionen, kompetente Aufsichtsorgane und politische Regulierungsmechanismen spürbar Grenzen gesteckt wurden, umso mehr nahm die Labilität der Kapitalmärkte zu. Hier liegt ein zentraler Streitpunkt zwischen den Neoliberalen und ihren Kritiker(inne)n, die in den sich gegenwärtig häufenden Kursstürzen ein untrügliches Indiz für das Scheitern jenes ökonomischen Ansatzes sehen, der die Forderungen nach tiefgreifenden Strukturreformen, wirksamen Interventionsmaßnahmen des Staates, planmäßiger Wirtschaftslenkung und strengeren Finanzmarktkontrollen fast reflexhaft abwehrt. Systemkosmetik und kleinere Korrekturen reichen nicht aus, um das zerstörte Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems wieder herzustellen. Wettbewerb, Leistungsorientierung und Gewinnmaximierung dürfen nicht mehr oberstes Gebot sein.
Gegen den Sozialstaat und sinnvolle Staatseingriffe
Während sich der „klassische“ Liberalismus als fortschrittliche Bewegung des Bürgertums in erster Linie gegen den Feudalstaat bzw. seine Überreste richtete, bekämpft der Neoliberalismus, verstanden als (Wirtschafts-)Theorie, Sozialphilosophie und politische Strategie, die den Markt zum umfassenden gesellschaftlichen Regulierungsmechanismus erheben möchte, jeglichen Staatsinterventionismus, der dem Kapital politische Fesseln anlegt. Seit der Weltwirtschaftskrise 1974/75 richtete sich die Kritik am Interventionsstaat gegen Reformen, die eine SPD/FDP-Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt nach der Schüler- bzw. Studentenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition (ApO) am Ende der 1960er- bzw. zu Beginn der 1970er-Jahre verwirklicht hatte. Für die weitere Entwicklung war das sog. Lambsdorff-Papier vom 9. September 1982 bedeutsam, dessen Forderungen nach spürbarer Verbesserung der Kapitalerträge und einer „Verbilligung des Faktors Arbeit“ durch Senkung der Sozialleistungsquote vor 25 Jahren zum Bruch der sozial-liberalen Koalition führten. Die nachträgliche Lektüre des Memorandums lässt erkennen, dass es sich um das offizielle Drehbuch für die Wirtschafts- und Sozialpolitik bis heute handelte und der „Marktgraf“ ein wichtiger Wegbereiter der neoliberalen Hegemonie war. So sehr entsprechen zahlreiche Maßnahmen, die seither ergriffen wurden, dem dort niedergelegten Handlungskatalog: Von einer zeitlichen Begrenzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes auf zwölf Monate über die Einführung eines „demografischen Faktors“ zur Beschränkung der Rentenhöhe („Berücksichtigung des steigenden Rentneranteils in der Rentenformel“) bis zur stärkeren Selbstbeteiligung im Gesundheitswesen listete das Lambsdorff-Papier fast alle „sozialen Grausamkeiten“ auf, welche die folgenden Bundesregierungen bis heute verwirklichten.
Nach dem Regierungswechsel Schmidt/Kohl ging der Neoliberalismus, dem Vorbild Margaret Thatchers in Großbritannien und Ronald Reagans in den USA folgend, auch in der Bundesrepublik von einer Fundamentalkritik am Interventionsstaat zur rigorosen „Reform“-Politik über. Seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Kollaps aller „realsozialistischen“ Staatssysteme in Ost- bzw. Ostmitteleuropa 1989 bis 1991 beeinflussen Neoliberale und Wirtschaftslobbyisten die öffentliche Meinung, das soziale Klima und die politische Kultur unseres Landes noch stärker. Offenbar entfiel mit der – gar nicht mal attraktiven – Systemalternative die letzte Sperre gegenüber der Transformation des „rheinischen“ Modells der Sozialen Marktwirtschaft zum „schweinischen“ Finanzmarkt- und Aktionärskapitalismus, wie er sich nunmehr fast auf der ganzen Welt durchsetzte.
Rolf-E. Breuer, als Vorstandssprecher der Deutschen Bank ein prominenter Fürsprecher des Neoliberalismus, erklärte die Finanzmärkte in einem Artikel der ZEIT (v. 27.4.2000) zur „fünften Gewalt“ und relativierte die Bedeutung demokratischer Verfassungsorgane. Zwischen der Politik und offenen Finanzmärkten existiere in Zeiten der Globalisierung nicht bloß eine „weitgehende Interessenkongruenz“, sondern Letztere seien auch „effiziente Sensoren“ gegenüber Fehlentwicklungen in einem Land, das schlecht regiert werde, ohne dass sie eine bestimmte Politik erzwängen. Regierungen sollten Anlegerwünsche, in denen Breuer die westlichen Wertvorstellungen manifestiert wähnt, deshalb auch viel stärker als bisher berücksichtigen: „Die berechtigten Interessen in- und ausländischer Investoren, der Wunsch der Finanzmarktteilnehmer nach Rechtssicherheit und Stabilität müssen respektiert werden. Diese Wünsche stehen freilich nicht im Gegensatz zu den Grundorientierungen einer an Wohlstand und Wachstum orientierten Politik, sondern sind mit ihnen identisch. Offene Finanzmärkte erinnern Politiker allerdings vielleicht etwas häufiger und bisweilen etwas deutlicher an diese Zielsetzungen, als die Wähler dies vermögen.“ Nach den Erfahrungen der letzten Zeit verwundern solche anmaßenden, Selbstüberschätzung und Demokratiefeindschaft ausdrückenden Formulierungen noch mehr, als dies bei kritischen Zeitgenoss(inn)en damals bereits der Fall war.
Kritik des Neoliberalismus
Statt der Bedarfs- präferieren Neoliberale Leistungsgerechtigkeit. Peer Steinbrück, seinerzeit nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, nahm eine totale Deformation des Gerechtigkeitsbegriffs vor und brach mit dem Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes, als er die soziale Gerechtigkeit auf die Sorge des Staates um die Leistungsträger verkürzte: „Soziale Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine Politik für jene zu machen, die etwas für die Zukunft unseres Landes tun: die lernen und sich qualifizieren, die arbeiten, die Kinder bekommen und erziehen, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze schaffen, kurzum, die Leistung für sich und unsere Gesellschaft erbringen. Um die – und nur um sie – muss sich Politik kümmern.“ (Die Zeit v. 13.11.2003) Neoliberale verstehen unter Leistung in erster Linie wirtschaftlichen Erfolg. Wenn ein Superreicher nach Rücksprache mit seinem Anlageberater an der Börse die richtigen Aktien kaufte und sie ein Jahr später zum doppelten oder dreifachen Preis verkaufte, musste er selbst einen Millionengewinn nicht versteuern. Ob darin eine Leistung besteht, die sich „lohnen“ muss, erscheint aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive fraglich. Bildete sich ein Arbeitnehmer in seiner Freizeit weiter, musste er den daraus resultierenden Mehrverdienst hingegen voll versteuern. Und auch die Bemühungen eines Menschen mit Behinderungen, seine körperlichen Einschränkungen durch unermüdliches Üben zu verringern, „rechneten“ sich nicht.
Dividenden, die bisher dem sog. Halbeinkünfteverfahren unterlagen, müssen ab 1. Januar 2009 voll und Kursgewinne aus Aktien- und Fondsanteilskäufen erstmals ohne Rücksicht auf eine (zuletzt zwölf Monate betragende) Spekulationsfrist versteuert werden. Beide unterliegen jedoch nunmehr genauso wie Zinsen einer Abgeltungssteuer, die unabhängig vom persönlichen Einkommensteuersatz des Bürgers pauschal 25 Prozent beträgt und die gültige Steuerprogression somit unterläuft. Davon profitieren insbesondere jene sehr wohlhabenden Einkommensbezieher, die den Spitzensteuersatz in Höhe von 42 bzw. 45 (sog. Reichensteuer) entrichten müssen, während sich Kleinaktionäre, die mittels entsprechender Wertpapiere privat für das Alter vorsorgen wollen, aufgrund ihres niedrigeren Steuersatzes eher schlechter als bislang stehen.
Viel entscheidender als Umverteilung von Geld sei, dass Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu den Bildungsinstitutionen und zum Arbeitsmarkt erhalten, heißt es. Zu fragen wäre freilich, weshalb ausgerechnet zu einer Zeit, in der das Geld aufgrund einer zunehmenden Ökonomisierung und Kommerzialisierung von Lebensbereichen wichtiger als früher, aber auch ungleicher denn je verteilt ist, seine Bedeutung für die Beteiligung der Bürger/innen am gesellschaftlichen Leben gesunken sein soll. Damit sie in Freiheit (von Not) leben, ihre Bedürfnisse befriedigen und ihre Pläne verwirklichen können, brauchen die Menschen nach wie vor Geld, das sie bei Erwerbslosigkeit, Krankheit und im Alter als soziale bzw. Entgeltersatzleistung vom Sozialstaat erhalten müssen. Mehr soziale Gleichheit bzw. Verteilungsgerechtigkeit bildet die Basis für Partizipationschancen benachteiligter Gesellschaftsschichten. Dies gilt beispielsweise für die (Aus-)Bildung und den Arbeitsmarkt. Ohne ausreichende materielle Mittel steht die Chance, an Weiterbildungskursen teilzunehmen und ihre persönlichen Arbeitsmarktchancen zu verbessern, etwa für Erwerbslose nur auf dem Papier.
Mit einer Deregulierung der Märkte sowie einer (Re-)Privatisierung öffentlicher Güter und sozialer Risiken zielt der Neoliberalismus auf „Kapitalismus pur“, also eine Marktgesellschaft ohne entwickelten Wohlfahrtsstaat und wirtschaftspolitischen Interventionismus. Während der Interventionsstaat abgelehnt wird, avanciert der Markt zum universellen Regelungsmechanismus, obwohl er die Gesellschaft im „Säurebad der Konkurrenz“ (Karl Marx) zersetzt, sie in Arm und Reich spaltet sowie die Rivalität zwischen und die Brutalität von Menschen tendenziell fördert. Neoliberal zu sein meint folglich nicht nur, den Markt für die effizienteste Regulierungsinstanz der Gesellschaft zu halten und auf Distanz gegenüber dem bestehenden, als bürokratisch verteufelten (Sozial-)Staat zu gehen. Neoliberal zu sein bedeutet auch mehr, als die Handlungsmaxime „Privat vor Staat“ zu beherzigen. Neoliberal heißt letztlich, unsozial und unsensibel für die wachsenden Existenzprobleme von Millionen Menschen – Arbeitnehmer(inne)n, Erwerbslosen und ihren Familien sowie Rentner(inne)n – zu sein. Indem planmäßig immer mehr Gesellschaftsbereiche dem Prinzip der Profitmaximierung unterworfen werden, nehmen die Handlungsräume von Individuen, die zu „Kunden“ und damit zu Objekten der Werbeindustrie herabgewürdigt werden, sowie die Entscheidungsautonomie demokratischer Institutionen zumindest tendenziell ab.
Wer – wie mancher Neoliberaler – die kapitalistische Ökonomie verabsolutiert, negiert im Grunde demokratische Politik und repräsentative Demokratie, weil beide Mehrheitsentscheidungen und nicht das Privateigentum an Produktionsmitteln zum Fixpunkt gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse machen. Um den „Standort D“ zu retten, stellte Jürgen Schrempp, seinerzeit Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aerospace AG und Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG, Mitte der 1990er-Jahre die politische Kultur der Bundesrepublik in Frage: „Das etablierte Vorgehen, das die politischen Entscheidungen von ihrer Mehrheitsfähigkeit abhängig macht, ist der heutigen Zeit nicht mehr gewachsen.“ Den damaligen BDI-Präsidenten Hans-Olaf Henkel trieben ähnliche Sorgen um. Er hielt das deutsche Verhältniswahlrecht für überholt und konstatierte: „Wenn es (…) so ist, daß der Wettbewerb zwischen Standorten eine relative Veranstaltung ist und daß wir selbst bei eigener Bewegung zurückfallen, wenn andere schneller auf die Herausforderungen der Globalisierung reagieren als wir, dann müssen wir uns fragen, ob unser politisches System eigentlich noch wettbewerbsfähig ist.“
Selbst das Grundgesetz ist Ultraliberalen ein Dorn im Auge, suchen sie doch sein Sozialstaatsgebot außer Kraft zu setzen und dem Markt nicht nur Vor-, sondern auch Verfassungsrang zu verschaffen. Dabei stören demokratische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, die (zu) lange dauern, Prinzipien wie die Gewaltenteilung und föderale Strukturen, weil sie Macht tendenziell beschränken, sowie der Konsenszwang eines Parteienstaates. Thomas Darnstädt lästerte denn auch in einem Spiegel-Heft (v. 12.5.2003), dessen Titelblatt das Grundgesetz als Erstausgabe mit Goldschnitt zeigt, auf die eine fast heruntergebrannte Kerze ihren Wachs unter der Überschrift „Die verstaubte Verfassung. Wie das Grundgesetz Reformen blockiert“ ergießt: „Das Grundgesetz der Hightech-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ähnelt einem VW-Käfer, Baujahr Mai 1949 – das waren die mit den Brezelfenstern.“
Totgesagte leben länger: der Neoliberalismus ist quicklebendig
Seit geraumer Zeit scheint es, als erlebe der (Wohlfahrts-)Staat eine Renaissance und als neige sich die Periode der Privatisierung von Unternehmen, öffentlicher Daseinsvorsorge und sozialen Risiken ihrem Ende zu. Noch ist die neoliberale Hegemonie jedoch ungebrochen und verschärft nicht nur die soziale Asymmetrie, bedeutet vielmehr auch eine Gefahr für die Demokratie, weil sie politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozess entwertet. Viele (junge) Menschen resignieren vor der scheinbaren Übermacht des Ökonomischen gegenüber dem Politischen und ziehen sich ins Privatleben zurück, statt sich für eine bessere Welt zu engagieren.
Marktradikale müssten nach dem Scheitern ihrer Liberalisierungs-, Deregulierungs- und Privatisierungskonzepte eigentlich in Sack und Asche gehen, haben aber schon wieder Oberwasser. Sie waren nie gegen Staatsinterventionen ganz allgemein, sondern nur gegen solche, die Märkte und Profitmöglichkeiten beschränken. Dagegen sind selbst massive Eingriffe wie das deutsche 480-Mrd.-Paket zur Rettung der Banken und des Finanzsektors ausgesprochen erwünscht, wenn hierdurch die Börsen stabilisiert und die Gewinnaussichten der Unternehmen verbessert werden. Dabei handelt es sich um einen marktkonformen Staatsinterventionismus im Sinne der Großwirtschaft, die selbst entsprechende Konzepte vorgeschlagen und gemeinsam mit den zuständigen Ministerien entwickelt hat.
Das für den Gegenwartskapitalismus kennzeichnende Kasino im Finanzmarktbereich wird derzeit nicht – wie etwa die globalisierungskritische Organisation attac verlangt – geschlossen, sondern mit Steuergeldern saniert und modernisiert. Angela Merkel wollte ausgerechnet Hans Tietmeyer, zunächst Staatssekretär im Finanzministerium, dort eigentlicher Verfasser des Lambsdorff-Papiers, später Präsident der Bundesbank und Kuratoriumsvorsitzender der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM), zum Chefberater für die Reorganisation der Finanzmärkte ernennen. Da sollte mithin der Bock zum Gärtner gemacht werden, wie auch der IWF als Weltfinanzaufsicht vorgeschlagen wird. Als könnte Teufel mit Beelzebub ausgetrieben werden! All das unterstreicht nur die fehlende Bereitschaft der handelnden Personen, einen wirklichen Neuanfang zu wagen.
Selbst die FAZ (v. 8.10.2008) spricht vom Neoliberalismus mittlerweile in der Vergangenheitsform: „Der Neoliberalismus war eine Abenteuergeschichte, und die ganze Gesellschaft fieberte mit. Heute kommt sie uns vor wie eine Käpt’n-Blaubär-Story. Wir brauchen eine neue Geschichte.“ Zwar befindet sich der Neoliberalismus in einer Legitimationskrise, seinen dominierenden Einfluss auf die Massenmedien und die öffentliche Meinung sowie die politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse büßte er bisher jedoch keineswegs ein. Obwohl die Finanzmarktkrise von den angelsächsischen Musterländern einer „freien Marktwirtschaft“ ausging, ist die neoliberale Hegemonie in der Bundesrepublik, der Europäischen Union und den USA bisher ungebrochen. Die öffentliche Meinungsführerschaft der Marktgläubigen fußt darauf, dass sie entweder die Fehlentscheidungen einzelner Personen (Spitzenmanager, Investmentbanker) oder das Versagen des Staates und seiner Kontrollorgane (Politiker, Finanzaufsicht) für das Fiasko verantwortlich machen. Neoliberale überraschen durch flotte Sprüche (Friedrich Merz: „Mehr Kapitalismus wagen!“) und staatstragendes Verhalten (FDP-Vorsitzender Guido Westerwelle). Sehr geschickt nutzen prominente Neoliberale die Talkshows und andere öffentliche Bühnen, um „der Politik“ den Schwarzen Peter zuzuschieben und ihnen staatliches Kontrollversagen vorzuwerfen.
Es wäre verfrüht zu glauben, der Neoliberalismus hätte seine Macht über das Bewusstsein von Millionen Menschen verloren, nur weil sie um ihr Erspartes fürchten und mit ihren Steuergroschen ein Mal mehr die Zeche für Spekulanten und Finanzjongleure zahlen müssen. Gleichwohl bleibt zu hoffen, dass die globale Finanzmarktkrise zur Überwindung der neoliberalen Hegemonie – hier verstanden als öffentliche Meinungsführerschaft des Marktradikalismus – und zur allgemeinen Rehabilitation der Staatsintervention beiträgt. Stellt man die Frage, was nach dem Neoliberalismus kommt, sollte man die beiden Perspektiven eines sich radikalisierenden und eines seriöser auftretenden, noch subtiler agierenden Marktfetischismus nicht übersehen.
Folgen der Weltfinanzkrise für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Während die das Krisendebakel wesentlich mit verursachenden Hasardeure und Spekulanten mittels des „Finanzmarktstabilisierungsfonds“ aufgefangen werden, müssen Arbeitslose und Arme die Suppe, welche uns Banker, Broker und Börsianer eingebrockt haben, vermutlich einmal mehr auslöffeln. Wenn die Große Koalition ausgerechnet auf dem Scheitelpunkt von einer Konjunktur- zur Krisensituation die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung auf 2,8 Prozent, d.h. den niedrigsten Stand seit der Weltwirtschaftskrise 1974/75 senkt, sind drastische Leistungskürzungen bereits vorprogrammiert. Die vergleichbare Sanierung des schwedischen Bankensektors bildete während der 1990er-Jahre den Rahmen für einen Um- bzw. Abbau des dortigen Sozialstaates, was sich hier und jetzt wiederholen könnte. Da die Haushalte von Bund und Ländern durch Bürgschaften und Kredite in Milliardenhöhe strapaziert sind, lassen sich Leistungskürzungen natürlich leichter als sonst legitimieren. Statt Konjunkturprogramme aufzulegen und die Binnenkonjunktur durch gezielte Steigerung der öffentlichen Investitionen anzuregen, neigt die Bundesregierung zu einer Verschärfung ihres Austeritätskurses. Wenn sie überhaupt noch Geld für „Wohltaten“ zugunsten der Bürger/innen hat, gibt sie es so aus, dass Transferleistungsempfänger/innen und sozial Benachteiligte nicht in den Genuss von Vergünstigungen kommen, etwa im Falle eines Vorziehens der steuerlichen Absetzbarkeit von Beiträgen zur Krankenversicherung, die Bundeswirtschaftsminister Glos empfiehlt.
Da sich die Verteilungskämpfe um knapper werdende gesellschaftliche Ressourcen und die Finanzmittel des Staates zwangsläufig intensivieren, dürfte das soziale Klima hierzulande demnächst erheblich rauer werden. Ohne historische Parallelen überstrapazieren und durch den Blick zurück die aktuelle Krisensituation dramatisieren zu wollen, denkt man unwillkürlich an die Weltwirtschaftskrise gegen Ende der 1920er-/Anfang der 1930er-Jahre. Damals leiteten Bankpleiten und Börsenzusammenbrüche international den Niedergang von Unternehmen und riesige Entlassungswellen ein, die Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau sowie Not und Elend großer Bevölkerungskreise nach sich zogen, bevor der NSDAP und ihrem „Führer“ Adolf Hitler am 30. Januar 1933 die Machtübernahme gelang. Der schnelle Aufstieg des Nationalsozialismus wäre ohne diese spezifischen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen kaum möglich gewesen.
Ähnlich groß ist heute die Gefahr für die Demokratie, wenn der Sozialstaat erneut durch eine Weltwirtschaftskrise und einen drastischen Beschäftigungseinbruch unter Druck gerät. Nie gestaltet sich der geistig-politische Nährboden für Rechtsextremisten günstiger, als wenn diese auf die „Juden von der amerikanischen Ostküste“ verweisen und vom sozialen Abstieg bedrohten Gesellschaftsschichten geeignete Sündenböcke präsentieren können. Wenn sich bei der ohnehin erodierenden Mittelschicht die Furcht ausbreitet, in den von der Finanzkrise erzeugten Abwärtssog hineingezogen zu werden, sind irrationale Reaktionen und politische Rechtstendenzen mehr als wahrscheinlich. Davon könnte wiederum ein Signal an die Eliten ausgehen, das bestehende Gesellschaftssystem durch autoritäre Herrschaftsformen zu konsolidieren. Sofern das parlamentarische Repräsentativsystem in einer solchen Umbruchsituation scheinbar blockiert und durch seine Hilflosigkeit gegenüber Krisenerscheinungen der Ökonomie diskreditiert ist und die Politik der etablierten Parteien als durch mächtige Lobbygruppen korrumpiert gilt, haben rechtsextreme bzw. -populistische Gruppierungen relativ gute Chancen, die politische Kultur des Landes maßgeblich zu beeinflussen und auch bei Wahlen erfolgreich zu sein. Umso wichtiger wäre es, fundierte gesellschaftspolitische Alternativkonzepte zum Neoliberalismus zu entwickeln und möglichst viele Menschen für eine soziale, humane und demokratische Krisenlösung zu gewinnen. Auch dafür bietet die Situation geeignete Anknüpfungspunkte.
Dieser Artikel erschien zuerst in Heft 1/2009 "Hintergrund – Das Nachrichtenmagazin".
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.
Der Autor:
Prof. Dr. Christoph Butterwegge, geb. 1951, lehrt Politikwissenschaft an der Universität zu Köln und ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates von attac. Im Laufe des Jahres 2008 hat er die Bücher „Kritik des Neoliberalismus“, „Neoliberalismus. Analysen und Alternativen“, „Rechtspopulismus, Arbeitswelt und Armut“ sowie „Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland“ veröffentlicht.