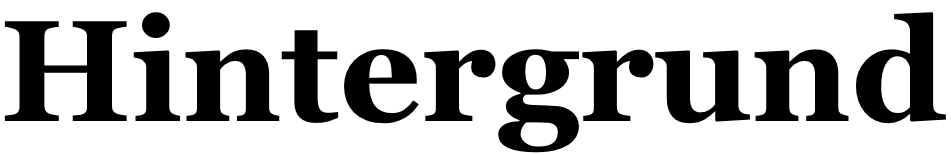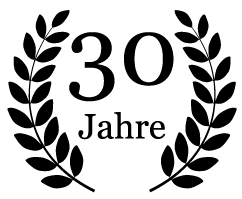Power to the People - Ein janusköpfiger Wahlsieg
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Ein Kommentar von JUTTA DITHFURTH anlässlich der US-Wahlen, 10. November 2012 –
Seit Jahrzehnten zerfallen in den USA nicht bloß Schulen und Brücken, sondern ganze Städte. Als ich 1972 kurze Zeit in Detroit lebte, in einem vorwiegend afroamerikanischen Stadtviertel, fuhr ich auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag durch Slums, vorbei an verfallenden Holzhütten und verrottenden Industriebauten. Auf manchen Dächern sah ich noch Spuren der Luftangriffe der Polizei von 1967, durch die viele Menschen verletzt oder getötet worden waren.
Wie oft haben wir im Fernsehen während der ersten Präsidentschaftskampagne von Barack Obama Ausschnitte aus Martin Luther Kings „I have a dream“-Rede von 1963 gesehen? Gefühlte eine Million Mal? King träumte von Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit, auch der vom Rassismus. Um Obama als Heilsbringer zu mystifizieren, wurde Kings Rede 2008 missbraucht, als sei sie sein letztes Wort zu den sozialen Verhältnissen in den USA gewesen. Es sollte die Illusion befördern, dass der Kapitalismus eine humane Lebensweise sein kann, wenn ein Afroamerikaner Präsident wird.
Im Juni 1967 kam es in 75 US-amerikanischen Städten zu Aufständen von Afroamerikanern und ihren politischen Freunden. Die Revolte erfasste Cincinnati, Memphis, Newark, Durham und Detroit. Die blutigsten Kämpfe erlebte Detroit. Die Regierung setzte sogar Fallschirmjäger und Panzer ein. Ganze Stadtviertel gingen in Flammen auf. Dreiundachtzig Menschen, vor allem Afroamerikaner, wurden getötet. 4000 wurden verletzt, 8000 verhaftet.
Martin Luther King wurde am Ende seines Lebens für das weiße Establishment zu einer Bedrohung. Es ging ihm nicht mehr nur um demokratische Bürgerrechte – also darum, dass ein „schwarzes“ Mädchen auf eine „weiße“ Schule gehen oder ein Afroamerikaner Präsident werden kann –, sondern um die sozialen und demokratischen Menschenrechte für alle. Martin Luther King sagte: „Ich habe jahrelang an der Idee gearbeitet, die bestehenden Institutionen der Gesellschaft zu reformieren – ein wenig Veränderung hier, ein bisschen Fortschritt dort. Doch jetzt bin ich zu einer anderen Überzeugung gelangt: Ich glaube, man muss die ganze Gesellschaft umstrukturieren – wir brauchen eine Revolution unseres Wertesystems!“
Er bereitete seinen großen „Feldzug der Armen“ vor, die Poor People’s Campaign, den Kampf gegen Krieg, Armut und Rassismus, die drei Säulen der Unterdrückung. King rückte näher an seinen vermeintlichen linksradikalen Gegenspieler Malcolm X heran, der 1965 ermordet worden war. King sagte, als er die Kampagne im Dezember 1967 ankündigte: „Wir müssen den Machtstrukuren massiv gegenübertreten. Dies ist ein Schritt, um die Situation zu dramatisieren, um den sehr legitimen und verständlichen Zorn der Ghettos zuzuspitzen, und wir wissen, dass wir dies nicht mit etwas Schwachem tun können. Es muss etwas Starkes sein, Dramatisches, Aufmerksamkeiterregendes sein.“ Schwarze, Indianer, Latinos und Weiße waren aufgerufen, quer durch das Land eine Vielzahl von Aktionen gegen Staat und Kapital durchzuführen: Protestmärsche, Besetzungen, gewaltlose Sitzstreiks in Regierungsbehörden, Boykotts von Konzernen und Einkaufszentren.
Bereits seit seiner „Traum“-Rede von 1963 hielt das FBI King für den „gefährlichsten und einflußreichsten Neger-Führer“. Die Spitzen des FBI berieten, wie man ihm anhängen könnte, dass er Kommunist sei und wie man den Führer der Bürgerrechtsbewegung systematisch „neutralisieren“ und „zerstören“ könne. Man versuchte auch, ihn in den Selbstmord zu treiben. Die staatliche Überwachung und Bespitzelung umfasste – mit Zustimmung von Justizminister Robert Kennedy – Kings privateste Lebensbereiche.
In allen heutigen Medienberichten über Martin Luther King fehlt zielgerichtet stets seine Entwicklung in den letzten Lebensjahren. Von seinem „Traum“ einer bald zu erwartenden friedlichen und gerechten US-Gesellschaft hatte King sich verabschiedet, er radikalisierte sich. 1967 sagte er:
„Ich musste erkennen, wie mein Traum zum Alptraum wurde, als ich durch die Ghettos unseres Landes ging und sah, dass meine schwarzen Brüder und Schwestern auf einer einsamen Insel der Armut dahinsiechen – in der Mitte eines riesigen Ozeans von materiellem Wohlstand, und ich sah, dass unsere Nation nichts unternimmt, um die Probleme der Schwarzen zu lösen.“
Immer schärfer stellte er sich gegen den Vietnamkrieg. King wurde am 4. April 1968, zu Beginn der Poor People’s Campaign, ermordet. Er war erst 39 Jahre alt. In 110 Städten kam es zu Aufständen. Die Auftraggeber seines Mörders wurden bis heute nicht gefunden. […]
49 Millionen Menschen in den USA, unter ihnen 16 bis 17 Millionen Kinder, haben nicht ausreichend zu essen. Sie leben in Haushalten mit „Lebensmittelunsicherheit“. So der im November 2011 veröffentlichte Bericht der US-Behörde für Landwirtschaft (United States Department of Agriculture/USDA). Von gesundem, ökologisch wertvollem Essen ist da ohnehin nicht die Rede. Der im Repräsentantenhaus eingebrachte Haushaltsentwurf für 2012 sieht deutliche Einsparungen bei den staatlichen Lebensmittelprogrammen vor.
Den Hunger hat der damalige US-Präsident George W. Bush übrigens mit einem Schlag abgeschafft, indem er ihn in „sehr niedrige Lebensmittelsicherheit“ umtaufte. Noch in seiner Amtszeit (2001–2009), vor der Rezession, stieg der Anteil der Empfänger von Lebensmittelkarten um 4 Millionen Menschen. Allein in der Stadt Philadelphia – hier wurden die USA einmal gegründet – hatte ein Viertel der Bevölkerung schon 2009 nicht genug zu essen, das waren 352 000 Menschen. So sehen sie aus, die Verhältnisse im gelobten Land der „working poor“, der arbeitenden Armen. Natürlich existieren in Philadelphia noch keine Verhältnisse wie im ärmsten Afrika. Wer ein kompliziertes Antragsverfahren übersteht, konnte im Monat Lebensmittelmarken im Wert von maximal 176 US-Dollar erhalten. Aber ohne die 40 000 privaten und kirchlichen Suppenküchen im Land herrschten Verhältnisse wie in Somalia, sagt ein Aktivist.
Unter Barack Obama, Präsident seit Januar 2009, ist der Hunger weiter gestiegen. Demokraten und Republikaner streiten über die Höhe der Kürzungen der Lebensmittelprogramme. Der mehrheitliche demokratische Senat stimmte im Juni 2012 dafür, das Lebensmittelmarkenprogramm (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP) um 5,4 Milliarden US-Dollar zu kürzen, die Republikaner verlangten noch größere Einschnitte. Dass Obama im Wahlkampf von 2008 einmal versprochen hatte, bis zum Jahr 2015 den Hunger aller Kinder zu beseitigen, ist vergessen. We can, but we won’t. Das gleichfalls in seinem ersten Wahlkampf versprochene Bildungsprogramm für arme Kinder hat Obama schon im Februar 2009 größtenteils der Kritik der Republikaner geopfert, um sein Konjunkturprogramm durchzusetzen.
Der für 2013 behauptete Abzug aus Afghanistan ist kein Abzug von Waffen. Präsident Barack Obama hat Afghanistan im Juli 2012 als ersten Staat in seiner Amtszeit zu einem „Nicht-NATO- Hauptverbündeten“ erklärt. Als solcher hat Afghanistan, wie 14 andere Staaten weltweit, einen erleichterten Zugang zu US-Rüstungsgütern. […]
„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.“ Sagte Warren E. Buffett, der heute drittreichste Mann der Welt im November 2006 der New York Times. Das war ein Jahr vor dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, aber deren „Vorläufer“, die US-Immobilienkrise, hatte bereits begonnen. Buffet sagte dies keineswegs aggressiv, und er kritisierte zudem, dass reiche Leute wie er zu wenig Steuern zahlen müssen.
Der Krieg, von dem er sprach, ist nicht vorbei. Im Gegenteil, er ist längst in einer härteren Phase.
Buffett unterstützte Barack Obama in dessen erstem Wahlkampf 2008, er beriet den Präsidenten, und auch für die Wahl 2012 galt: „Well, Barack Obama, he’ll be my choice.“ Die USA erlebe ihr wirtschaftliches „Pearl Harbor“, erklärte Buffett Anfang 2009. Der Angriff der japanischen Luftwaffe auf Pearl Harbor hatte den USA 1942 den Anlass geliefert, in den Zweiten Weltkrieg einzutreten. Obama sei einer, der „den Amerikanern die Schwere der wirtschaftlichen Situation richtig übermitteln“ könne und der „gleichzeitig Hoffnung auf Besserung“ verbreite.
Wer die Geschichte der Black-Power-Bewegung in den USA kennt, wusste um die Bedeutung der Wahl des ersten Afroamerikaners zum Präsidenten der USA. Aber es war ein janusköpfiger Sieg, denn vor allem in Krisenzeiten nützen solche charismatischen Technokraten dem Kapital. Obama steht nicht für die reale Verbesserung des Lebens sozial benachteiligter US-Bürger, sondern lediglich für die Modernisierung des Kapitalismus. Seine Wahl war auch nicht der „Nebeneffekt“ einer starken sozialen Bewegung, sondern nur das Symbol einer Wahlkampagne, die erfolgreich Erinnerungen an die Bürgerrechtsbewegung und an die Antikriegsbewegung früherer Jahrzehnte wachrief.
Hätten sich Malcolm X und Martin Luther King träumen lassen, dass der erste schwarze US-Präsident Kriege führen und Foltergefängnisse unangetastet lassen würde? Dass er nicht einmal den Abbau von demokratischen und sozialen Rechten der vorangegangenen republikanischen Präsidenten zurücknehmen würde? Obama ist ein technokratischer Verwalter der kapitalistischen Krise, mehr Macht hat er nicht.
In Zeiten großer gesellschaftlicher Krisen muss in den Zentren des Kapitalismus gelegentlich auch die fortschrittlichere Fraktion der staatstragenden Parteien an die Regierung, um unzufriedene oder gar oppositionelle Teile der Bevölkerung zu befrieden und Revolten vorzubeugen, vor allem dann, wenn tiefe Einschnitte in das soziale Leben oder neue Kriege bevorstehen. So wurde 1998 die SPD in die Bundesregierung gewählt und als ihr Juniorpartner die Grünen. Der erste Krieg mit deutscher Beteiligung seit 1945, der gegen Jugoslawien, stand bevor, und das Kapital verlangte scharfe Einschnitte in den deutschen Sozialstaat. Zum Nutzen dieser Interessen mussten größere Teile der reformistischen Linken, Reste grüner Pazifisten und vor allem die Gewerkschaftsspitzen eingebunden werden.
Kein republikanischer US-Präsident hätte 1996 die Sozialausgaben so rigide zusammenstreichen können wie der demokratische US-Präsident Bill Clinton, ohne dass wütende Proteste ausgebrochen wären. Obama besitzt ein noch größeres Befriedungspotenzial, welches er und seine Regierung auch benötigen, um die USA in der Weltwirtschaftskrise zusammenzuhalten, so dass es nicht zu einem Chaos kommt, an dessen Ende die herrschende Ordnung zerrüttet ist. Auch in seiner zweiten Amtszeit wird die Armut wachsen und die USA ein kriegführender imperialistischer Staat sein. Auch unter einem demokratischen Präsidenten wird die soziale Frage – sofern die Betroffenen sich ihrem Schicksal nicht ergeben und ihre legitimen Aggressionen statt gegen die Schuldigen ausschließlich gegen sich selbst richten – weiterhin vor allem durch eine autoritäre Sozialverwaltung, Polizei, Justiz und Armee „gelöst“ werden.
Gekürzte, ansonsten unveränderte Auszüge aus: Jutta Ditfurth Zeit des Zorns. Warum wir uns vom Kapitalismus befreien müssen, Frankfurt/Main: Westend Verlag Sept. 2012, 292 S., 16,99 €.
S. 22-22, 66/67 und 231-233. Quellen und Belege im Buch!
© Jutta Ditfurth 2012