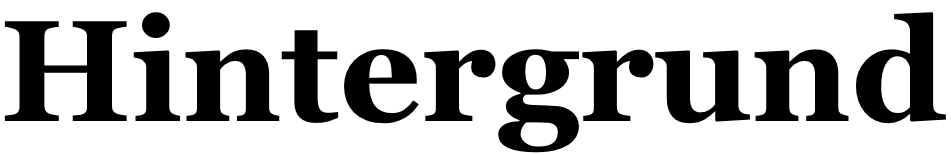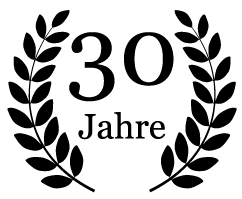Sieger der Eurokrise
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Die europäische Staatsschuldenkrise kennt nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner –
Von HERMANNUS PFEIFFER, 31. Mai 2012 –
Im ersten Moment scheint die Geschichte ein schlechter Witz zu sein. Hedgefonds drohen mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sollten sie per Gesetz zu einem Schuldenschnitt in Griechenland gezwungen werden. Die New York Times beruft sich auf Gespräche zwischen Finanzinvestoren und ihren Anwälten. Ausgangspunkt für eine Klage in Straßburg wäre eine Verletzung der Eigentumsrechte, die in der EU gleichsam als Menschenrecht gelten. Mit ihrer PR-Attacke kontern die risikofreudigen Investoren eine Drohung der griechischen Regierung, private Gläubiger per Gesetz zu einem Forderungsverzicht zu zwingen. Sollte es tatsächlich zu einem Schuldenschnitt kommen, würden die Manager der betroffenen Hedgefonds versuchen, sich per Gerichtsbeschluss schadlos zu halten. Sie wären im Erfolgsfall nicht die einzigen Sieger der Eurokrise.
In Krisen gibt es Verlierer. Aber es gibt immer auch Sieger. Beides gilt auch für Finanzkrisen. Unser Bild der großen Krise, die seit dem Sommer 2007 die Weltwirtschaft durchrüttelt, wird weitgehend geprägt von amerikanischen Hausbesitzern, die ihre Heimstatt verlieren, von der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers, von Schiffen, die infolge des eingebrochenen Welthandels im Winter 2010 still im Hamburger Hafen liegen, von griechischen Schuldenbergen und billionenschweren staatlichen Rettungspaketen in den USA, Europa und Japan. Doch wo Verlierer sind, finden sich auf den Finanzmärkten auch Sieger. Schließlich funktionieren viele Finanzgeschäfte wie Wetten: Wer falsch getippt hat, verliert, wer richtig getippt hat, gewinnt. Und wie im Spielcasino, um eine etwas betagte Metapher hervorzukramen, gewinnt bei vielen Finanztransaktionen immer auch die Bank. In der Eurokrise, die im Grunde eine Staatsschuldenkrise und eine Folge der Banken- und Finanzkrise seit 2007 ist, gehören zu den Siegern unter anderem Fonds, deren Geschäftsmodell auf die Verwertung von „Schrottpapieren“ setzt. Sieger sind aber auch große Banken sowie der Fiskalhaushalt der Bundesrepublik.
Euro weicher als D-Mark
Grundsätzlich zahlt sich der Euro trotz teurer Rettungspakete unterm Strich für Deutschland und seine Wirtschaft aus. Die staatliche KfW-Bank hat die wirtschaftliche Entwicklung „mit“ und „ohne“ Euro einmal durchgerechnet. Das Ergebnis zeigt, dass die Währungsunion dem „Zahlmeister Europa“ nicht schadet, sondern nutzt. Der Euro bringt danach einen Wohlstandsgewinn von jährlich bis zu dreißig Milliarden Euro. „Um diesen Betrag“, so KfW-Chefvolkswirt Norbert Irsch, „wäre die wirtschaftliche Leistung weniger gestiegen, wenn wir die D-Mark gehabt hätten.“
Irschs Aussagen basieren auf einer „Abschätzung des quantitativen Vorteils des Euro für Deutschland gegenüber einer fiktiven D-Mark“. Dieser Vorteil resultiere daraus, heißt es in dem zweiseitigen Papier, „dass das deutsche Wachstum mit einer eigenen Währung in den letzten beiden Jahren durch höhere Zinsen und eine härtere Währung niedriger ausgefallen wäre“. Im Klartext: Nutzen zieht Deutschland aus den niedrigeren Zinsen, die Unternehmen und auch die Bundesregierung seit der Euro-Einführung für Kredite und Anleihen zu zahlen brauchen. Ein weiterer Vorteil ist die im Vergleich zur Deutschen Mark weichere Währung. Durch den niedrigeren Wechselkurs des Euro können hiesige Firmen Medikamente, Werkzeugmaschinen und Fleischwaren außerhalb der Eurozone preiswerter anbieten – ein Wettbewerbsvorteil – auf Kosten Dritter. Von Niedrigzinsen und Weichwährung profitiert im europäischen Vergleich besonders die bundesdeutsche Wirtschaft, weil sie extrem auf den Export ausgerichtet ist. Beispielsweise die deutsche Automobilindustrie: Von fünf Millionen Pkw, die sie pro Jahr hergestellt, werden vier Millionen exportiert, zwei Millionen davon in Nicht-Euroländer.
Unterm Strich hat Deutschland durch die Mitgliedschaft in der Eurozone in den letzten beiden Jahren laut KfW einen Wachstumsvorteil zwischen 2,0 und 2,5 Prozentpunkten erreicht. Ein weiterer Vorteil der Währungsunion ergibt sich aus den geringeren „Transaktionskosten“. So entfallen die Umtauschgebühren, wenn Chemikalien nach Frankreich oder Italien geliefert werden. Zudem müssen sich BASF, Daimler oder Siemens nicht mehr gegen Währungskursschwankungen kostspielig absichern, wenn sie Produkte innerhalb des Euroraumes im- oder exportieren. Dieser Aspekt blieb in dem vorliegenden Papier der früheren „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ sogar noch unberücksichtigt. Der Eurovorteil für Deutschland kann also noch höher angesetzt werden, als es die KfW tut.
Finanzminister Schäuble spart Milliarden an Zinsen
„Es kommen noch große Lasten auf Deutschland zu“, unkte unlängst Hans-Werner Sinn, Präsident des Ifo-Institutes in München, über die Auswirkungen der Eurokrise und die teuren Rettungspakete, die Deutschland schultert. Doch es kann auch in diesem Fall ganz anders kommen, als Sinn vermutet. Für die Bundesrepublik kann die Eurokrise, sollte es gelingen, die Finanzmarktakteure bis Ende 2012 in ihre Schranken zu weisen, zu einem Riesengeschäft werden. Besonders für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lohnt sich die Krise bereits: Griechenland und die anderen gestützten Krisenländer zahlen satte Strafzinsen; die Bundesbank wird 2012 milliardenschwere Extragewinne überweisen; und für die 275 Milliarden Euro, die der CDU-Politiker Schäuble 2011 neu an Krediten für den Staat aufnahm, wird die Bundesregierung Zinsen im zweistelligen Milliardenbereich einsparen.
Vorab: Die diversen Rettungspakete und die vom Bundestag abgesegneten Euro-Rettungsfonds EFSF und der ab Sommer aktive Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) kosten die Bundesregierung bis auf Weiteres kaum einen Cent: EFSF und ESM bestehen nämlich überwiegend aus Bürgschaften. Stattdessen wird in Berlin, Paris und Helsinki ordentlich abgesahnt, denn Portugal, Irland und Griechenland zahlen hohe Strafzinsen für die üppigen Hilfskredite. So überwies allein Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos (PASOK) für das vergangene Jahr zwei Milliarden Euro als Zinsen an den europäischen Finanzstabilisierungsfonds. Angesichts des deutschen Anteils an diesem Rettungspaket flossen aus Athen also allein 2011 rund 400 Millionen Euro in die Berliner Kassen.
Kasse macht Finanzminister Schäuble auch über die Tochtergesellschaft der Europäischen Zentralbank (EZB), die Bundesbank. Denn der Bundesbankgewinn wandert zum großen Teil in den Bundeshaushalt. Griechenlands Finanzminister – der im Herbst 2011 wochenlang bei der „Troika“ aus EZB, Europäischer Union und Internationalem Währungsfonds (IWF) um eine Hilfszahlung von überschaubaren acht Milliarden Euro nachsuchen musste – überwies nämlich nicht nur zwei Milliarden Euro an Strafzinsen, sondern auch 16 Milliarden Euro Zinsen für reguläre Kredite. Von diesen 16 Milliarden strömte schätzungsweise die Hälfte zu Banken und Versicherungen, die andere Hälfte zur EZB, die zwischenzeitlich viele Euro-Krisenpapiere übernommen hat. Für Schäuble wird daher aus dem Bundesbankgewinn für 2011 ein üppiger zusätzlicher Milliardenbeitrag herausspringen.
Doch die Eurokrise lohnt sich für die Regierung Angela Merkels besonders beim eigenen Schuldenmachen, denn die Renditen für Bundesanleihen sind auf einem Rekordtief angekommen. Seit dem Ausbruch der Euro-Schuldenkrise boomt die Nachfrage nach deutschen Schuldentiteln, da Profiinvestoren und Amateuranleger seither in Scharen in drei sichere Häfen fliehen: Gold, Schweizer Franken und Bundesanleihen. Angesichts der überquellenden Nachfrage muss der Bund nur noch Niedrigstzinssätze anbieten, um seine Anleihen x-fach überzeichnet zu bekommen. In Anbetracht einer Inflationsrate von über zwei Prozent bringen Anleger faktisch sogar noch Geld mit, wenn sie ihr Geld in bundesdeutschen Wertpapieren vergleichsweise sicher anlegen.
Im laufenden Jahr will der Bund insgesamt 250 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Ein Batzen, der deutlich größer ausfällt als die Einnahmen durch Steuern und Abgaben. Die vielen Milliarden benötigt Schäuble hauptsächlich, um alte Schulden zu tilgen, aber auch, um Zinsen zu zahlen und um die Staatsausgaben zu finanzieren. Mittlerweile eine preiswerte Pflicht, so musste die dafür zuständige Finanzagentur des Bundes GmbH, Frankfurt am Main, für eine zehnjährige Staatsanleihe Ende 2011 nur noch 1,96 Prozent Zinsen anbieten. Zum Vergleich: Italien muss 5,65 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen zahlen, Irland 7,53 und Portugal 10,96. Selbst Frankreich, das mit Deutschland zusammen in der Ersten Liga der Staatsanleiher spielt, muss infolge der Eurokrise einen drei viertel Prozentpunkt mehr Zinsen an die globalen Investoren aufbieten, um an frisches Geld zu kommen. Dieser nominal kleine Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland zeigt per Zinseszinseffekt große Wirkung: Die Euroflucht in Bundesanleihen beschert Finanzminister Schäuble nämlich allein für die Neuverschuldung im vergangenen Jahr eine außerordentliche Zinsersparnis von überschlagsweise 25 Milliarden Euro.
Auch 2012 werden erhebliche Erträge aus Euro und Krise für den deutschen Fiskus anfallen. Man sollte der Bundesregierung deswegen vielleicht nicht gleich unterstellen, dass sie die Staatsschuldenkrise anfacht, doch in einer (vorläufigen) Bilanz der Eurokrise müssen diese Gewinne verbucht werden. Und sie könnten nachhaltig sein, wenn am Ende der Krise die Bürgschaften der Staaten für die Rettungspakete nicht oder kaum eingelöst werden, es also bei Verpflichtungen bleibt und ihnen keine handfesten Zahlungen folgen müssen. Dann dürfte die deutsche Schlussrechnung einen dicken Überschuss ausweisen.
Banken profitieren von hohen Zinsen
Auch Banken gehören zu den Siegern der Krise. Doch während sich Schäuble über niedrige Zinssätze freut, schätzen Bankmanager hohe Zinsen. Für Banken dreht sich fast alles um den Zins (nicht die Tilgung), und die Zinsen, die hoch verschuldete Staaten wie Irland, Spanien oder Italien seit Langem zahlen, sind überdurchschnittlich attraktiv. Dahinter steht, dass Banken jede Geldanlage vornehmlich zwischen den Polen „Rendite“ und „Risiko“ abwägen.
Für Banken wurden Rendite und Risiko nach dem öffentlichen Startschuss zum Euro, am 1. Januar 2002, zu einem besonders spannenden Thema. Die Länder der sogenannten Euro-Peripherie galten schon bald als Wackelkandidaten. Durch die gemeinsame Währung konnten sie nicht mehr Drachme, Lira oder Peso abwerten, um ihre technisch unterlegene Wirtschaft durch niedrige Preise im internationalen Wettbewerb zu schützen. Geschwächte Unternehmen, niedrigere Steuereinnahmen, höhere Schulden – bereits bald nach der Euro-Einführung drifteten die Zinssätze zwischen den Ländern auseinander.
In den Euro war also schon von Anfang an die Krise miteingebaut. Und mit der großen Krise, die das Platzen einer Immobilienblase im Sommer 2007 in den USA ausgelöst hatte, explodierte dieser „Spread“ geradezu: Während deutsche Anleihen für Staat und Unternehmen immer billiger wurden, wurden mögliche „Schrottanleihen“ immer teurer. Das ist bitter für die betroffenen Länder, treibt deren Staatsverschuldung zusätzlich in die Höhe und senkt deren internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter – ein Teufelskreis. Aber ein Teufelskreis, von dem viele Banken seit Langem profitieren, denn sie konnten extrahohe Zinssätze kassieren. Übrigens in einer weltweit historischen Niedrigzinsphase. Was die früh eingebaute Eurokrise besonders attraktiv machte.
Solange Irland, Portugal und andere Länder nicht wirklich ins Straucheln gerieten, war die latente Eurokrise ein tolles Geschäft für viele Banken. Und wer seine Bilanzen im Griff hatte, wie die Deutsche Bank, für den blieben die „Schrottanleihen“ insgesamt selbst in der akuten Krise lukrativ. Daran würde auch ein Schuldenschnitt des relativ kleinen Griechenland nichts ändern, der einige Hedgefonds so in Rage bringt, dass sie vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen wollen.
Wer seine Geschäfte nicht im Griff hatte, wie die Commerzbank/Dresdner Bank oder griechische Kreditinstitute, dem drohten und drohen Probleme, denn mitten in der großen Krise waren die Finanzakteure obendrein gezwungen, heikle Staatsanleihen „abzuschreiben“. Was vorher 100 Euro wert war, steht nun nur noch mit 70, 50 oder 20 Euro in der Bilanz. Und wer zuviel „Schrottpapiere“ in den Büchern stehen hatte, kriegte betriebswirtschaftlich Probleme. Abschreibungen können eine Bank sehr schnell an den Rand einer Pleite führen. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit gelten als zwingende Insolvenzgründe. Die Politik änderte daraufhin seit 2008 mehrfach die Abschreibungsmodalitäten und erlaubte „Bad Banks“, in denen toxische Papiere in die Quarantäne abgeschoben werden konnten, um die Bilanzen zu desinfizieren. Abschreibungen und Bad Banks dürfen jedoch nicht mit realen Verlusten verwechselt werden – die entstünden erst bei einem Verkauf der maladen Wertpapiere. Von diesen neuen Möglichkeiten, die der Staat als Reparaturbetrieb des Kapitalismus in höchster Not schuf, profitieren viele Banken nun auch in der Eurokrise.
Banken konnten neben hohen Zinssätzen und Abschreibungen noch von einem dritten Effekt profitieren, der die Eurokrise begleitete. Wie in anderen unruhigen Zeiten wurden von Investoren, Fonds und Versicherungen weit mehr Transaktionen abgewickelt als in ruhigen Zeiten. Davon profitieren die Banken ganz besonders, denn weit umfangreicher als die eigenen Kapitalanlagen in Aktien und Anleihen sind die Geschäfte, die sie für Dritte tätigen. Kleinanleger, Investoren oder Konzerne zahlen für diese Dienstleistungen milliardenschwere Gebühren und Provisionen. Diese bilden für viele Banken einen wichtigen, für Investmentbanken sogar den entscheidenden Einnahmeposten. Von den 33,2 Milliarden Euro Ertrag (vor Kosten), welche die Deutsche Bank AG für das Geschäftsjahr 2011 verbuchte, entfällt ein Drittel, 11,5 Milliarden Euro, auf den „Provisionsüberschuss“. So viel wie noch nie.
Geschäfte mit dem Abfall
Noch einmal das Beispiel Deutsche Bank: Sie will einen neuen Fonds auflegen, der von hochriskanten Hedgefonds Vermögenswerte aufkauft, die an sich derzeit unverkäuflich sind. Dies wurde im Januar bekannt. Solche Junk-Bond-Fonds machen ihre Geschäfte mit finanziellem Abfall (engl. junk). Gemeint sind damit Finanzprodukte, die von Rating-Agenturen oder Banken eine sehr schlechte Bewertung erhalten, wie etwa die Staatsanleihen einiger hoch verschuldeter Euroländer oder Papiere, für die es zeitweise keinen Markt gibt. Entsprechend niedrig ist der Preis, den der Deutsche-Bank-Fonds für die „Abfallpapiere“ an die Hedgefonds zahlen wird. Die Spekulation dahinter: In zwei, drei Jahren, nach dem Ende der Eurokrise, lassen sich die Wertpapiere wieder zu einem höheren Preis gewinnträchtig veräußern, oder der Fonds kassiert bis zum Ende der Laufzeit ausreichend Zinsen für die erworbenen Anleihen. Solche Junk-Bond-Fonds leben von der Krise wie die Abfallverwerter von unserem Hausmüll.
Weniger anrüchig, aber doch einem ähnlichen Konzept folgend, agieren viele Investoren auf den Finanzmärkten. Seit Längerem ist zu beobachten, dass die Kurse von Aktien, Anleihen, Immobilien etc. stärker schwanken als bis in die 1990er Jahre hinein. Diese hohe Volatilität schafft für Investoren Möglichkeiten, die es bei ruhiger See nicht gibt: „Wenn sich ein Markt häufiger auf- und abwärtsbewegt, dann bietet er einem Investor auch mehr gute Ein- und Ausstiegsgelegenheiten als ein Markt, der kaum Schwankungen unterliegt“, analysiert Immobilienexperte Hubert Spechtenhauser von Hannover Leasing. Und die Eurokrise schlägt hohe Wellen.
Gewinnen, wenn die Kurse fallen
Wenn die Kurse steigen, machen Spekulanten Gewinne. Das erscheint normal. Wie aber kann man aus fallenden Kursen Profit ziehen? Einer richtigen Antwort auf diese Frage verdankt George Soros seinen Weltruhm als Zocker. Soros‘ Idee: Er verkauft am Tag X Aktien, Wertpapiere oder Devisen, die er noch gar nicht besitzt, zu einem bestimmten (in der Zukunft liegenden) Termin Y; sein Portefeuille ist also am Anfang jeweils „leer“. Soros trieb dabei die Hoffnung, dass er die fehlenden Wertpapiere am Stichtag Y billiger als am Tag X werde erwerben können. So kann durch Leerverkäufe mit null Kapital eine gewaltige Wirkung erzielt werden – andererseits droht dem Zocker aber auch die Pleite. Soros hatte hinreichendes Glück, und so verfügte er 1992 über genügend Kapital, um auf diese Art gegen die Bank von England auf Augenhöhe zu spekulieren. Und das äußerst erfolgreich. Was die zweitälteste Zentralbank der Welt angeblich zur (überfälligen) Abwertung des britischen Pfundes zwang und das europäische Währungssystem in Turbulenzen stürzte. Soros blieb aus dem Deal eine Milliarde US-Dollar als Gewinn. Solche „Short Seller“ oder „Leerverkäufe“ erfreuen sich in der Eurokrise größter Beliebtheit, denn viele Kurse von Finanzanlagen schwanken stärker den je.
Ein weiteres Derivat (engl. abgeleiteter Wert) kommt in der Eurokrise zum Einsatz: Kreditausfallversicherungen oder Credit Default Swaps (CDS). Sie dienen traditionell Banken und Unternehmen dazu, sich gegen mögliche Verluste bei Exportkrediten, Staatsanleihen oder anderen Darlehen abzusichern. In jüngerer Zeit erwarben zunehmend Spekulanten solche CDS, ohne überhaupt Staatsanleihen zu besitzen, und wetteten damit wie Soros „leer“ auf die Pleite von Eurostaaten. Da die Risikoprämien gerade dieser CDS-Wertpapiere und deren Auf und Ab von wichtigen Akteuren auf den Finanzmärkten als Signale wahrgenommen werden, können sie auch Staatsanleihen in Bedrängnis bringen. Die Folge sind höhere Zinssätze, die Staaten für ihre neuen Schulden bieten müssen.
Aufstieg und Fall
Von der Banken-, Finanz- und Staatsschuldenkrise seit 2007 wurden vor allem angelsächsische Großbanken wie die Royal Bank of Scotland oder die Citigroup hart getroffen. Aber auch Kreditinstitute in der Euro-Problemzone und Finanzdienstleister in Osteuropa, die überwiegend zu Finanzkonzernen in Österreich und Italien gehören, sind unter den Verlierern. In Deutschland konnten Spezialinstitute wie die Hypo Real Estate (HRE), Landesbanken und die Nummer zwei, die Commerzbank, nur dank staatlicher Hilfen und Kapitalbeteilungen vor dem Fall ins Nichts bewahrt werden.
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.
Doch wo Verlierer sind, sind auch hier Gewinner, dieses Mal im Konkurrenzkampf der Konzerne. So stieg die Deutsche Bank im Laufe der Krise wieder in die globale Spitze der Branche auf. Auch die Bedeutung der Finanzplätze verschob sich. So drehte sich die Auseinandersetzung um die konkrete Ausgestaltung der Euro-Rettungspakete wie zuvor bei der Bankenrettung immer auch um die „nationalen“ Interessen der Retter. Die Renationalisierung der Politik zielt darauf ab, die „eigenen“ Finanzdienstleister gegenüber der europäischen und globalen Konkurrenz zu schützen und zu bevorteilen. Gewinner und Verlierer zeichnen sich in diesem Ringen heute noch nicht eindeutig ab. Weltweit dürfte der allgemeine Megatrend, dass sich das weltwirtschaftliche Zentrum in Richtung Asien verschiebt, durch die große Krise wie durch die Eurokrise verstärkt worden sein. In Europa selbst dürfte die Schiene Deutschland-Frankreich-Luxemburg-Niederlande-Finnland an Gewicht gewonnen haben.
Doch egal, ob man einsteigt oder aussteigt, jeder Akteur auf den Finanzmärkten braucht ein Gegenüber, das beispielsweise die Griechenland-Anleihe kauft, die man verkaufen möchte. Ein Nullsummenspiel – was der eine verliert, gewinnt der andere. Insofern wirkt das spekulative Treiben der Sieger der Eurokrise undramatisch, wäre da nicht die Gefahr eines Dominoeffektes unter den Verlierern. Das Nullsummenspiel stellt nur so lange keine Gefahr für eine Volkswirtschaft dar, wie die Verlierer zahlungsfähig bleiben. Fallen einzelne Dominosteine, wie im Mai 2010, als Griechenland und bald darauf Portugal sowie Irland ins Straucheln gerieten und wenig später Regierungen und Sozialsysteme, droht der Finanzkapitalismus zu kollabieren. Ob es dazu in der Eurozone kommt, bleibt weiter offen. So blieb es bislang nur bei der Drohung der Hedgefonds-Manager, den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg einzuschalten. Zum Lachen ist dieser Witz aber nicht.
Der Artikel erschien zuerst in Hintergrund, Heft 2, 2012.