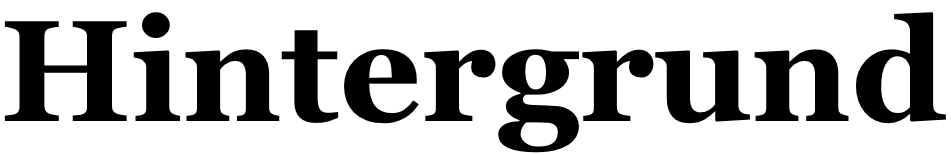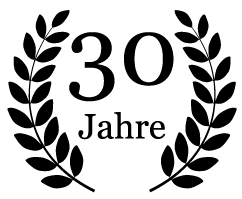Die Facebook-Falle
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft –
Von SASCHA ADAMEK, 7. Juli 2011 –
Dass ich mich überhaupt für Facebook zu interessieren begann, hatte damit zu tun, dass Facebook sich im Dezember 2009 plötzlich für mich interessierte. Damals fand ich in meinem E-Mail-Konto zwei Einladungen vor, im Namen zweier Freunde abgesendet von Facebook. Es waren Freunde aus meinem realen Leben, daher nahm ich an, dass sie hinter den Einladungen steckten. Als irgendwann ein dritter Freund hinzukam, rief ich die Leute an und sagte ihnen, dass ich gern ihr Freund sei, aber nicht auf Facebook. Die Serie der Einladungen riss trotzdem nicht ab. Irgendwann stand unter einer dieser E-Mails der Satz: „Weitere Personen auf Facebook, die du vielleicht kennst.“ Die Sache wurde mir allmählich unheimlich. Denn dort tauchten wieder die Freunde auf, die mich bereits erfolglos eingeladen hatten, sowie ein Professor Heinz G., an den ich mich nur noch dunkel erinnern konnte. Der Professor hatte einige Jahre zuvor versucht, mich per E-Mail zu einem Fernsehbeitrag zu animieren – ein beruflicher Kontakt, der bereits nach wenigen Wochen wieder abriss. Und davon wusste Facebook offenbar. Wie war das möglich? Ich rief Heinz G. an und fragte ihn, wie er dazu komme, Facebook meine E-Mail-Adresse mitzuteilen. Schweigen am anderen Ende der Leitung. Mein Gegenüber hatte nicht den blassesten Schimmer, was ich von ihm wollte. Als ich ihm die Sachlage schilderte, räumte er kleinlaut ein, dass sein Sohn für ihn die Facebook-Seite betreue und er selbst nicht viel damit zu schaffen habe. Dass sein Sohn jedoch meine Kontaktdaten an Facebook weitergeleitet habe, könne er sich nicht vorstellen.
Mit der Zeit erfuhr ich, dass Facebook vielen Leuten solche merkwürdigen Einladungen schickt, und so beschloss ich, mich intensiver mit diesem „sozialen“ Netzwerk zu beschäftigen und der Frage nachzugehen, warum das US-Unternehmen sich so eifrig in unserer Privatsphäre zu schaffen macht. Aber wie stellt er das an? Die Antwort hat viel mit der Legende als „Freundesnetzwerk“ zu tun, mit dem sich dieser mittlerweile geschätzte mehr als 50 Milliarden Dollar schwere Kommunikationskonzern erfolgreich versieht. Was früher noch alternativ und jugendlich angehaucht war, gehört heute einfach dazu. So hat Facebook eine simple Funktion, zu der es uns permanent einlädt: „Durchsuchen deines E-Mail-Kontos ist der schnellste Weg, um deine Freunde auf Facebook zu finden.“ Es folgt die Aufforderung: „E-Mail-Passwort eingeben“. Damit gemeint ist das Passwort unseres gewöhnlichen E-Mail-Kontos und damit eigentlich ein Tabu für jeden Internetnutzer, denn seien wir ehrlich, das E-Mail-Passwort überlassen wir nicht einmal unseren Lebenspartnern. Bei Facebook tun das Millionen und der Konzern verspricht treuherzig: „Wir werden dein Passwort nach dem Import der Informationen deiner Freunde nicht speichern.“ Nachdem wir also das getan haben, ermöglichen wir Facebook einen tiefen Blick in unsere Adressbücher zu werfen, samt sämtlicher sonstiger Aufzeichnungen, wie Geburtsdaten, Postadressen oder Notizen zu dieser Person. Namen und E-Mail-Adressen beschafft sich Facebook auf diese Weise – um dann in unserem Namen an diese Nicht-Mitglieder heranzutreten. Ich nenne das aggressive Werbung – deutsche Datenschützer nennen das rechtswidrig, denn auf diese Weise gelangt Facebook an die Daten von Menschen, die vielleicht nie im Leben etwas mit dem Netzwerk zu tun haben wollen und das, ohne dass diese etwas davon ahnen, geschweige denn um ihr Einverständnis gefragt wurden.
Der technische Vorgang dieser gigantischen Datenübertragung an ein Unternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, hat mich neugierig gemacht. Im Institut für Internetsicherheit der Fachhochschule Gelsenkirchen sagte man uns Unterstützung zu. Ein brisanter Test entlarvt eine Sicherheitslücke.
Dazu bauten die Informatiker Marco Smiatek und Malte Woelky eine Versuchsanlage, in der sie den Datenabfluss aus dem iPhone genauestens kontrollieren konnten. Zunächst meldeten sie eine fiktive E-Mail-Adresse an, samt geheimem Passwort, mit dem wir den Zugang zu unseren E-Mails gegen andere schützen können. Dann gaben sie erfundene Daten in das fiktive Adressbuch ein, Daten von Freunden, die keine Facebook-Mitglieder waren. Einen Freund nannten wir Max Mustermann, dessen Freundin Paula Irgendwas. Zu Max Mustermann notierten wir außerdem: „Sucht neuen Arbeitgeber. Abwerben möglich. Ist sehr geschwätzig.“ Und nebenbei gaben wir noch weitere Kontakte intimerer Art ein: „Sexy Schnitte“ mit einer erfundenen Mobilnummer. Die Experten luden nun die Kontaktdaten zu Facebook hoch. Eigentlich müssen diese Daten in dem Moment, wo sie unsere Quelldateien verlassen, samt Passwort verschlüsselt und damit unsichtbar
für Außenstehende werden. Dann fingen die Informatiker die gesendeten Daten ab, um zu sehen, ob sie tatsächlich verschlüsselt worden waren. Zuerst probierten sie es mit einem einfachen Kodierungs- bzw. Dekodierungsprogramm, Base-64, das zum Beispiel der technischen Umformatierung von E-Mail-Anhängen dient. Ein einfaches Programm, das jeder kostenlos im Internet herunterladen kann, wenn er es nicht schon auf seinem Rechner hat.
Mit Hilfe dieses Programms versuchten sie nun, die Daten sichtbar zu machen. Das Ergebnis war ebenso erstaunlich wie niederschmetternd. Das Programm spuckte die eingegebenen Daten eins zu eins wieder aus. In den Datenströmen fanden sich sämtliche Details aus dem Adressbuch wieder: nicht nur E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Name von Max Mustermanns Freundin Irgendwas, sondern auch der Vermerk über seine Geschwätzigkeit und die Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Und natürlich auch die „Sexy Schnitte“ samt lesbarer Mobilnummer. Wer seine Kontaktdaten an Facebook hochlädt, übergibt dem Netzwerk damit sämtliche vertraulichen Information aus seinen Adress- und Kontaktdateien. Der Test der beiden Informatiker förderte zugleich ein weiteres, für Facebook nicht gerade schmeichelhaftes Ergebnis zu Tage. Während Facebook in seinen Datenschutzrichtlinien verspricht: „Wenn du vertrauliche Daten, wie z. B. Kreditkartennummern und Passwörter, eingibst, werden diese Informationen mithilfe der SSL-Technologie (Secure Socket Layer) von uns verschlüsselt“, schüttelten die Informatiker ungläubig den Kopf, als es ihnen mit dem einfachen Base-64-Programm nicht nur gelang, alle übertragenen Daten, sondern sogar das E-Mail-Passwort – für jeden Internet-Nutzer ein kleines Heiligtum – wieder lesbar zu machen. Von der zugesicherten Verschlüsselung kann also keine Rede sein.
„Wir gehen davon aus, dass die Entwickler bei der Online-Einführung des Dienstes die SSL-Verschlüsselung einfach vergessen haben“, sagte Malte Woelky. Die Sicherheitslücke betraf die gesamte Funktion Freundessuche, unabhängig davon, ob wir die Daten aus dem iPhone, über Outlook, über E-Mail-Portale wie WEB.DE oder jeden anderen E-Mail-Provider auslesen ließen. Über diesen Skandal berichtete ich gemeinsam mit meiner Kollegin Monika Wagener im Mai 2010 im ARD-Magazin MONITOR. Der Facebook-Konzern reagierte unmittelbar nach der Sendung auf die Veröffentlichung des Tests und schloss die Sicherheitslücke noch in derselben Nacht. Das allerdings, so habe ich es während der Recherchen zu meinem Buch erfahren, gehört zu den Grundstrategien dieses Konzerns. Erst auf öffentliche Kritik wird reagiert – manchmal entschuldigt sich der Facebook Gründer und Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg öffentlich, um dann trotzdem die gleichen Wege weiter zu verfolgen.
Sicherlich ist Facebook auf den ersten Blick sehr nutzerfreundlich, sprich: einfach bedienbar. Doch genau darin liegt häufig die Tücke. So sucht Facebook zwar potentiell verlorengegangene „Freunde“ für uns, im Grunde dient es aber seiner eigenen Expansion. Eine Strategie, die aufgeht, denn längst marschiert das Netzwerk auf die Marke von weltweit 600 Millionen Mitgliedern zu – wäre Facebook ein Land, wäre es das drittgrößte dieser Erde. Und bei dieser Expansion gehört es dazu, dass der Konzern auch die Daten von Nicht-Nutzern ins Visier nimmt. Sollte sich unter den Leserinnen und Lesern des Hintergrund auch der eine oder andere einmal auf die Seiten von Bild.de verirren, so sollte er sich klar sein, dass auch Nicht-Mitglieder von Facebook auf diesen Wege von Facebook ins Visier genommen werden können. Dieser Trick führt über einen kleinen Knopf, den neben Bild.de mehrere Hunderttausend Partnerseiten von Facebook integriert haben. Er zeigt einen kleinen weißen, nach oben gerichteten Daumen und darunter steht „Gefällt mir“ oder „Empfehlen“. Es handelt sich um eine Kernidee von Facebook – denn hier können Facebook-Mitglieder direkt ihr Gefallen äußern – das wiederum meldet das System auf den Seiten ihrer Freunde, die nun wissen, dass mir dieser oder jener Bericht „gefallen“ hat – dieses oder jenes Produkt, ein Song, ein Film oder ausnahmsweise eine Facebook-Seite eines Politikers.
Auf diese Weise werben wir „unter Freunden“, was natürlich für wirkungsvoller gehalten wird, als wildfremde Werbungen. Denn seien wir ehrlich: gibt es eine glaubwürdigere Werbung als die durch unsere Freunde. Diese Strategie heißt im Werberjargon „Empfehlungsmarketing“. Nun gut, sollte man denken, das kann man ja mitmachen oder es bleibenlassen und bedienen kann diesen Knopf auch nur, wer Facebook-Mitglied ist. Allerdings können mit diesem Button noch andere Funktionen verbunden sein, von denen Nicht-Mitglieder von Facebook auch nicht das Geringste ahnen. Das führte mir bei einem Besuch der Datenschutzbehörde von Schleswig-Holstein die Informatikerin Marit Hansen vor. Sie will mir etwas zeigen, das vor allem Nicht-Mitglieder von Facebook betrifft. Sie hat an ihrem PC keinen Facebook-Account. Sie ruft einfach die Seite von Bild. de auf. Anschließend überprüft sie, ob Cookies auf ihren PC heruntergeladen wurden, und ist überrascht: Schon bei einem einfachen Klick auf die Bild.de-Seite platziert Facebook zwei Cookies auf ihrer Festplatte, ohne dass sie zuvor den Empfehlungsbutton angeklickt hätte. Cookies sind weit verbreitet in der Netzwelt. Wenn ich eine Website aufrufe, nisten sich diese Miniprogramme in meinem PC ein. Sie melden dann jeden meiner weiteren Besuche auf der Website dem Absender. Bei den Cookies, die Marit Hansen identifizierte, handelt es sich um sogenannte persistente Cookies, die für längere Zeit – in diesem Fall zwei Jahre – auf der Festplatte bleiben. Für Facebook sind sie Gold wert, denn sie markieren Benutzer eindeutig und ermöglichen eine Wiedererkennung.
Im Fall von Facebook sind die Cookies aber noch wirksamer, denn wenn ich auf eine andere mit Facebook verbundene Seite klicke, erfährt das Facebook ebenfalls. „Facebook kann über zwei Jahre sehen, wo ich mich im Netz aufhalte, auf welcher Webseite ich aktiv bin“, resümiert Marit Hansen. Bei vielen Internetdiensten verlängert sich der Aufenthalt der Cookies mittlerweile bei jedem neuen Aufruf innerhalb der Zwei-Jahres-Frist um weitere zwei Jahre. Allerdings können Google, Amazon und Co. das Netzverhalten nur anonymen IP-Adressen zuordnen. Sie wissen nicht, wer vor dem PC sitzt. So ist es zwar auch bei Facebook, aber nur solange man dort nicht angemeldet ist. Holt man dies eines Tages nach, hat Facebook bereits jahrelang das eigene Netzverhalten ausspähen können: „Facebook weiß dann unter Umständen mehr über mich, als ich selbst noch in Erinnerung habe“, sagt Marit Hansen. „Es entsteht ein umfassendes Psycho- und Sozialprofil.“
Auf meine umfassende Anfrage bei Facebook antwortet Facebook mit einem Satz: „Unseres Wissen werden die IP-Adressen von Nicht-Nutzern nicht über die Social Plugins von Facebook gespeichert.“ Ausführlich dagegen antwortet mir die deutsche Facebook-Partner-Website Bild.de. Tobias Fröhlich, Sprecher von Bild.de, schreibt, die Kommentarfunktion des „Gefällt-mir“- bzw. „Empfehlen“-Buttons biete Bild.de-Lesern „einen interessanten Zusatznutzen“. Zu der Tatsache, dass Facebook die Website von Bild.de nutzt, um Millionen von Menschen zu verfolgen, die gar nicht bei Facebook angemeldet sind, meinte Fröhlich: „Bild.de hat Facebook das Setzen von Cookies bei Nicht-Facebook-Mitgliedern nicht gestattet. Bild.de bekommt über Facebook-Cookies keine Rückmeldungen über das Nutzerverhalten von Nicht-Facebook-Mitgliedern. Es ist auch nicht im Interesse von Bild.de, Nutzer-Daten über Facebook-Cookies zu sammeln.“
Offenbar hält Facebook selbst seine Partner nicht unbedingt auf dem Laufenden darüber, auf welche Weise Facebook die Daten von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern dieses sozialen Netzwerks abgreift. Und erst recht nicht deutsche Datenschutzbehörden, die das von Facebook wissen wollen. Aufgrund von Beschwerden von Nicht-Facebook-Mitgliedern über die merkwürdigen Facebook-Einladungen schrieb der Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein einen Brief an den angeblichen Datenschutzbeauftragten von Facebook, Chris Kelly in Palo Alto. Weichert berief sich auf Beschwerden von Bürgern, die sich fragten, wie ihre E-Mail-Adressen in die Datenserver von Facebook gelangt waren. Weichert wollte wissen, wie Facebook Daten von Nicht-Mitgliedern speichert und für welchen Zweck. Und ob Facebook das Netzverhalten von Nutzern verfolgt, um bei ihnen gezielte Werbung platzieren zu können. Ob das Unternehmen Daten an Dritte weitergebe. Thilo Weichert setzte Facebook in seinem Brief eine einmonatige Frist zur Beantwortung seiner Anfrage, nach deren Ablauf er sich „weitere Schritte“ vorbehielt.
Nach mehreren Ermahnungen erhielt er schließlich drei Monate später von dem neuen Facebook-„Datenschutzbeauftragten“ Richard Allan aus London eine Antwort auf seine Anfrage. Allerdings handelt es sich bei Allan in Wahrheit um einen ehemaligen britischen EU-Abgeordneten, der seit dem Sommer 2009 Chef-Lobbyist von Facebook für Europa ist. Allans Antwort an Weichert fiel alles andere als zufriedenstellend aus. So forderte er den deutschen Datenschützer gleich zu Beginn auf, ihm die Beschwerdefälle zu nennen, damit er einschätzen könne, ob die Fälle sich erledigt hätten, oder ob es erforderlich sei, „sie direkt zu kontaktieren„. Von einer staatlichen Datenschutzbehörde zu verlangen, Daten von Beschwerdeführern an Facebook weiterzuleiten, offenbart, gelinde gesagt, ein sehr laxes Verständnis von Datenschutz.
Richard Allan bestritt übrigens in dem Schreiben, dass Facebook Daten von Nicht-Nutzern sammle. Vielmehr ermögliche das Netzwerk, wie viele andere Internetdienste auch, seinen Nutzern lediglich, Kontakt-Informationen Dritter hochzuladen. Mit dieser Interpretation bewegt sich Facebook auf einem erstaunlichen argumentativen Niveau: Wir Nutzer selbst sind es, die die Daten hochladen, und wir tun es „purely voluntarily“ – absolut freiwillig. Wir tun es zwar über die Server von Facebook und angeleitet von Facebook, aber Facebook ist nach dieser Logik im Prinzip gar kein eigener Akteur, sondern lediglich eine Plattform. Anders ausgedrückt: Facebook ist eine Art Cyber-Gespenst, und wer davor erschrickt, ist selber schuld. Thilo Weichert hat den Eindruck, dass für den Konzern „Datenschutz nicht existiert, dass das als eine lästige Befindlichkeit von Europäern, insbesondere von Deutschen wahrgenommen wird.“ Kurz: Facebook hat einfach kein wirkliches Interesse an der Einhaltung europäischer Datenschutz-Standards und ich glaube nach meinen Recherchen, sie verstehen die Mentalität hinter unserer Kritik auch nicht wirklich. Der Datenschützer Thilo Weichert sagte mir mal scherzhaft, wenn Mark Zuckerberg mal wieder zum Weltwirtschaftsforum nach Davos komme, könne man ja die Radkappen seiner Limousine beschlagnahmen, um Bußgelder durchzusetzen. Weichert ist Realist. Aber er fügte auch hinzu, dass der nächste Schritt gegen die deutschen Partnerfirmen von Facebook gehen müsse. Die unterliegen deutschem Recht und sind auch für Bußgeldbescheide zu erreichen. Setzt sich Weicherts Linie durch, müssen also alle Webseiten, die Facebook über den „Gefällt-mir“-Button behilflich sind, Cookies bei Nicht-Mitgliedern zu setzen auf datenschutzrechtliche Verfahren einstellen.
Bleibt die Frage, warum wir unsere Privatsphäre so bereitwillig aufzugeben bereit sind. Denn immerhin überantworten wir diesem Konzern vieles von dem, was uns im richtigen Leben interessiert, unsere Bedürfnisse und Meinungen. Und, nutzen wir Facebook-Places und besitzen ein Smartphone, kann uns Facebook sogar in unsere Lieblings-Pizzeria verfolgen, wo dann allen unseren „Freunden“ per GPS gemeldet wird, dass wir wieder einmal dort sind. Vor Jahren noch haben Bürger Volkszählungen boykottiert. Die Datensammelwut des Staates war ihnen unheimlich. Die Preisgabe unserer Privatheit in einem neuen „digitalen Ich“ beruht auf ganz persönlichen Bedürfnissen. Wir wollen nicht allein sein und ein Netzwerk wie Facebook bietet auch dem Einsamen eine Gemeinsamkeit.
Die Schweizer Agentur Rod Kommunikation AG unternahm im Jahr 2009 einen bemerkenswerten Versuch mit dem Titel „Facebookless“. Über eine eigene Facebook-Seite suchte die Agentur „Facebook-Junkies“, die bereit waren, für 30 Tage auf das Netzwerk zu verzichten, und ihre Abstinenzerfahrung aufzuschreiben. 50 Facebook-Nutzer im Alter von 17 bis 52 Jahren machten mit und erhielten dafür jeweils 300 Franken. Noch vor Beginn des Experiments fragte die Agentur die Teilnehmer nach ihrer Facebook-Nutzung und erfuhr, dass diese meist einem täglichen Ritual folgte: morgens vor der Arbeit ein kurzer Facebook-Check und abends die hemmungslose Langzeit-Session. Bei der Frage, was die Teilnehmer angesichts von 30 Tagen Abstinenz am meisten fürchteten, offenbarten die meisten das Hauptmotiv für ihre Facebook-Mitgliedschaft: Neugier.
Ein 27-jähriger Mann fürchtet sogar, seine leibhaftige ehemalige Freundin aus den Augen zu verlieren: „Mir wird es im kommenden Monat fehlen, dass ich meine Ex-Freundin nicht mehr ausspionieren kann und nicht mehr mitbekomme, was in ihrem Leben jetzt so läuft.“ Mit Liebe und Freundschaft hat das alles herzlich wenig zu tun. Die Probanden sollten auch kurz vor ihrer Abstinenz ihre Gefühle äußern: „Wie wenn ich mein Tagebuch aus der Hand geben würde“, schrieb eine 21jährige Frau. Und eine 52jährige teilte mit: „Facebook ist wie ein Fenster zur Welt, und ich bin jetzt nicht am Fenster.“ Die Ergebnisse des Schweizer Experiments sind zwar nicht repräsentativ, geben aber doch eindeutige Hinweise auf den starken Einfluss, den Facebook auf das Leben seiner Nutzer ausübt. Sind wir online, folgen wir damit einer schleichenden Sucht und dem sozialen Druck. Dafür spricht auch, dass im Nachhinein fast alle Teilnehmer einräumten, sie seien während ihrer Abstinenz entspannter, ausgeglichener gewesen. Viele gaben auch an, ihre Zeit im realen Leben intensiver verbracht zu haben als zuvor und Facebook nun weniger zu nutzen.
Der Soziologe Richard Sennet sagte einmal, dass wir dabei seien, unsere Kulturtechniken zu verlernen: „Rituale, uns mit Fremden wohlzufühlen“. Zugleich beginnen wir, uns mit uns selbst zu langweilen. Weil wir nicht mehr wissen, wie schön Geselligkeit ist, wissen wir auch nicht die Einsamkeit zu schätzen. Auf Facebook werden wir Entertainer auf Gegenseitigkeit. Und so kann das milliardenschwere Netzwerk darauf vertrauen, dass wir es nicht so schnell verlassen. Denn wer verlässt schon gerne seine Freunde?
Dieser „Freundschaftsterror“ geht mit einer immer umfassenderen Sammlung unserer privatesten, ja auch intimsten Daten einher. Daten, für die sich übrigens nicht nur Facebook selbst als Werbevermarkter interessiert, sondern längst auch Konsumgüterkonzerne. Sie beauftragen Softwarefirmen wie das US-Unternehmen Visible Technologies, die gezielt mit Filterprogrammen die Inhalte in den riesigen Datenströmen interaktiver Plattformen wie Facebook auf Meinungen durchforsten. Der Software-Riese habe Visible Technologies zum Beispiel beauftragt, in Netzinhalten systematisch zu erforschen, wie die globale Internetgemeinde das neue Programm Windows 7 beurteile, berichtet das Online-Magazin Wired.
Was in sozialen Netzwerken von wem diskutiert wird, lässt auch die CIA nicht kalt. Und so versorgt Visible Technologies auch die US-Regierung mit Auswertungen. Täglich werden eine halbe Million interaktive Webseiten durchforstet. Das Verfahren nennt sich „opinion mining“ – also das Abhören von Meinungen und ist technisch bereits so ausgereift, dass Sätze, die Menschen im Netz formulieren semantisch auf ihre Tendenz analysiert werden: finden Menschen ein Produkt, einen Politiker gut oder äußern sie sich negativ. Visible Technology ist übrigens ein von der CIA-Firma In-Q-Tel mitfinanziertes Unternehmen, für das soziale Netzwerke mit ihren aberhundert Millionen Mitgliedern eine unschätzbare Informationsquelle sind. Während der DNI (Director of National Intelligence) Open Source-Konferenz 2008 in Washington plauderte der damalige CIA-Direktor Michael Hayden gutgelaunt über den Stellenwert offener Quellen – wie sozialer Netzwerke – für seinen Geheimdienst: „Geheime Informationen sind nicht alles in unserem Beruf, und es macht wirklich Spaß, Probleme mit Hilfe von Informationen zu lösen, die Leute so dumm waren, offen ins Netz zu stellen.“
Wir sehen, auf Facebook warten nicht nur Freunde auf uns – insbesondere in den Ländern der sogenannten „Facebook-Revolten“ sind Oppositionelle auch in das digitale Messer von Regimen gelaufen. So gelang es zwar via Facebook viele Menschen für Proteste zu mobilisieren, aber dieser Effekt kann auch ins Gegenteil verkehrt werden: Der Segen der schnellen Vernetzung kann zugleich zum Fluch werden. So wurden in Iran 2009 Oppositionelle verhaftet, weil der Geheimdienst ihre Profile mit sämtlichen Aktivitäten und Verbindungen ausgewertet hatte, ja sogar eigene Facebook-Profile angelegt hatte, um Menschen auszuhorchen. Vor dem Sturz von Präsident Ben Ali in Tunesien gelang es der Regierung durch Pishing-Mails, die Facebook-Konten vieler Oppositioneller und Sympathisanten zu knacken. Die Leute gaben ihr Passwort ein und ahnten nicht, dass sie damit direkt auf die Server des Regimes umgelenkt wurden. Facebook selbst reagierte darauf erst viele Wochen später, als sich Oppositionelle beschwerten, dass bestimmte Meinungsäußerungen regelmäßig verschwanden. Solche Beispiele zeigen in dem gegenwärtigen Hype um Facebook: die Rolle des Netzwerks ist politisch janusköpfig und kann auch von autokratischen Regierungen missbraucht werden. Denn nichts macht uns Menschen so angreifbar, wie die ungezügelte Offenlegung unsere Privatsphäre: In unseren kapitalistischen Industriestaaten für die Datensammelwut von Konsumgüterkonzernen – in Diktaturen für den Staat.
Schon bei unserer Anmeldung auf Facebook werden wir automatisch animiert, möglichst viel von uns preiszugeben: unseren Wohnort, unser Alter, Geschlecht oder Beziehungsstatus (Single, verheiratet, geschieden, offene Beziehung oder: „es ist kompliziert“), unsere Position, Arbeitgeber, Universität. Und permanent fragt uns Facebook: „Was tust du gerade?“ Alles, was wir dort eingeben, verwendet Facebook, um uns zu scannen. Wir tun das alles, um dazu zu gehören. Facebook-Mitglieder laden jeden Monat etwa 3 Milliarden Fotos und 10 Millionen Videos hoch. Sie verwenden Facebook als digitales Album. Und pro Tag wird der „Gefällt-mir“ oder Like-Button 3 Milliarden Mal angeklickt.
Aus diesen vielen Regungen im Netz erfährt Facebook über die Menschen in 70 verschiedenen Ländern mehr als jemals zuvor eine Organisation oder Regierung. Aus diesem Raster bietet es dann der werbetreibenden Wirtschaft an, gezielte, auf uns zugeschnittene Werbung zu machen. So kann es anbieten entsprechende Werbeanzeigen bei Mitgliedern im Alter von 20 bis 30 in Neu-Anspach zu platzieren, die gern Nordic-Walking betreiben oder den katholischen Pfarrer, der auf „Frauensuche“ ist und sich für Viagra interessiert, sollte er jemals so naiv gewesen sein, das auf Facebook einzugeben. Der werbetreibenden Wirtschaft schreibt Facebook: „Du solltest Nutzer mit ähnlichen oder verwandten Interessen finden, die zwar dein Produkt nicht ausdrücklich nennen, jedoch an ähnlichen Produkten/Serviceleistungen interessiert sind oder deren Lebensstil bzw. Aktivitäten den von dir vermarkteten Produkten entsprechen.“
So verkauft Facebook unser Leben und verdient dabei mehr und mehr Milliarden. Für das Jahr 2011 prognostiziert der Branchendienst Emarketer Facebook Einnahmen aus der Werbung von 4 Milliarden Dollar, 2012 sogar von 5,7 Mrd. Dollar. Unsere „Freundschaften“ werden zu einem kommerziellen Ereignis. Dazu passt auch die Aktion, die ein bekannter Burgerbrater vor einiger Zeit unter dem Titel „Whopper-Sacrifice“ startete: Wer zehn Freunde löschte, erhielt dafür einen Whopper. Der Frikadellenbrater hat der Facebook-Freundschaft damit einen realen Marktwert verschafft: Ein „Freund“ ist ein Zehntel Whopper wert.
Der Artikel erschien zuerst in Hintergrund, Heft 2, 2011.