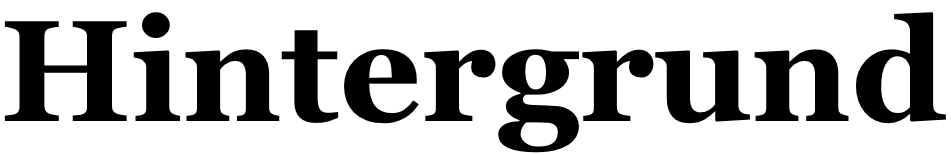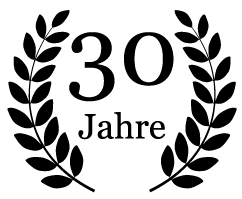„Mich macht so eine Selbstgefälligkeit sprachlos“
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Ulrich Teusch ist Journalist, Autor, Professor für Politikwissenschaft und Betreiber eines medienkritischen Blogs. In seinem neuen Buch Lückenpresse – Das Ende des Journalismus, wie wir ihn kannten analysiert er die aktuelle Vertrauenskrise der Medien und spürt den tieferliegenden Ursachen nach. Ein Gespräch über Selbstzensur, doppelte Standards und Medien, die vom „Wachhund“ zum „Kampfhund“ mutieren.
Herr Teusch, Ihr Buch trägt den Titel „Lückenpresse“. Das erinnert nicht zufällig an den Begriff „Lügenpresse“, von dem Sie sich im Text aber deutlich distanzieren. Was bedeutet „Lückenpresse“ und was ist am Wort „Lügenpresse“ aus Ihrer Sicht falsch?
Zunächst und ganz grundsätzlich: Wir haben seit gut zwei Jahren in diesem Land eine medienkritische Debatte, und diese Debatte ist aus meiner Sicht absolut begrüßenswert. Allerdings liegt mir daran, sie weiterzuentwickeln und in eine etwas andere Richtung zu lenken. Dazu taugt der Begriff „Lügenpresse“ wenig, weil er die Fronten zwischen Rezipienten und Journalisten unnötig verhärtet und obendrein analytisch sehr schwach ist. Damit will ich keineswegs in Abrede stellen, dass einzelne Journalisten hin und wieder bewusst die Unwahrheit sagen, also lügen. Ich will auch nicht leugnen, dass in den Medien immer mal wieder Lügen auftauchen. Das geschieht – ganz simpel – zum Beispiel dadurch, dass Politiker nicht selten Unwahrheiten sagen und Medien diese dann als Nachricht verbreiten. So etwas ist alles andere als unproblematisch. Der große amerikanische Journalist Charles Lewis und seine Mitarbeiter haben mal nachgezählt, wie viele Lügen die Bush-Administration in Zusammenhang mit dem Irak-Krieg im Jahr 2003 in Umlauf gesetzt hat. Es waren insgesamt 935! Und viele dieser Lügen wurden ganz selbstverständlich und ohne kritische Prüfung gedruckt und gesendet – mit desaströsen Folgen, wie wir wissen. Das wirft zweifellos einige höchst unangenehme und eminent wichtige Fragen auf. Dennoch glaube ich: Das eigentliche Problem sind nicht Lügen, sondern Lücken. Die entstehen zum Beispiel, wenn bestimmte Nachrichten regelrecht unterdrückt werden; das wären dann Lücken im Wortsinn. Der Begriff bezieht sich aber auch auf die Nachrichtengewichtung. Die eine Nachricht wird künstlich hochgespielt, die andere wird zwar irgendwo gemeldet, aber bewusst unten gehalten. Oder auf die Kontextualisierung von Nachrichten: Die eine Nachricht wird tendenziös eingebettet, mit einem „spin“ versehen, die andere nicht. Und so weiter. Und dann gibt es die „double standards“, also das Messen mit zweierlei Maß. All diese Mechanismen verstärken sich wechselseitig, und wenn sie in schöner Regelmäßigkeit auftreten oder sich bei bestimmten Themen zu einem flächendeckenden Phänomen auswachsen, entstehen Narrative, also große journalistische Deutungsmuster oder Erzählungen. In diese Narrative werden dann alle neu einlaufenden Informationen eingeordnet. Wenn sie ins Narrativ passen, ist ihnen Aufmerksamkeit gewiss, falls nicht, trifft sie das Lückenschicksal.
Nun könnte man einwenden, dass bei der Berichterstattung zwangsläufig immer Lücken bleiben, da man nun mal nicht über alles berichten kann und automatisch nur eine Auswahl an Ereignissen präsentiert. Sie sagen nun aber, die Lücken in den Nachrichten seien nicht bloß zufällig, sondern es gäbe sozusagen ein politisches Muster beim Weglassen und Verschweigen. Was ist das für ein Muster?
Sicher, jedes Medium ist notwendigerweise ein Lückenmedium. Selbst ein Mediensystem in seiner Gesamtheit kann kein irgendwie vollständiges oder objektives Bild zeichnen. Was man alles berichten könnte, steht in einem grotesken Missverhältnis zu dem, was man tatsächlich berichten kann. Trotzdem suggerieren unsere führenden Medien – also die Mainstreammedien, die ja im Zentrum meiner Kritik stehen –, dass sie relativ umfassend informieren und kommentieren. Warum sonst sollte sich eine Nachrichtensendung „Tagesschau“ nennen, warum sonst trägt eine Zeitung den Namen „Die Welt“? Da kommt dieser Anspruch ja sehr schön zum Ausdruck. Aber er ist natürlich anmaßend, weil gar nicht einlösbar. Das war schon immer so, das kann sich auch nicht ändern. Allerdings ließe sich das Problem ein wenig mildern, wenn es innerhalb des Mainstreams genügend Pluralität gäbe. Dann würde das eine Medium zwar eine Lücke hinterlassen, das andere sie aber füllen. Doch das ist nicht oder immer seltener der Fall. Was wiederum mit der zunehmenden Homogenisierung, dem Gleichklang des Mainstreams zusammenhängt; er entwickelt sich immer stärker zu einer interessengeleiteten Formation. Der mediale Mainstream ist im Grunde deckungsgleich mit dem politischen Mainstream. Wenn es dort Kontroversen gibt, spiegeln die Mainstreammedien diese wider-– sowohl in der Berichterstattung als auch in der Kommentierung; wenn der politische Mainstream sich aber weitgehend einig ist, dann ist es auch der mediale. Und wenn sich außerhalb des politischen Mainstreams Alternativen bilden, sei es links oder rechts davon, macht der mediale Mainstream nicht selten geschlossen Front dagegen. Das kann man aktuell wunderbar beobachten am Beispiel des linken Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn, wo eben nicht nur die Kommentierung, sondern auch die schlichte Berichterstattung über Corbyns Positionen und Einlassungen extrem einseitig ist. Das ist kein bloß subjektiver Eindruck meinerseits, sondern neuerdings durch zwei wissenschaftliche Studien belegt worden. Eine davon wurde von der London School of Economics erstellt, die in der Einseitigkeit der Berichterstattung sogar eine Gefährdung demokratischer Prozesse erkennt und den Medien vorwirft, vom „Wachhund“ zum „Kampfhund“ zu mutieren. Das Gleiche kann man natürlich bei geopolitischen Konflikten beobachten, in die „der Westen“ involviert ist. In meinem Buch findet sich da einiges etwa zur Russland- oder Syrienberichterstattung.
Welche Rolle spielt Selbstzensur in der Branche nach Ihrer Erfahrung? Wird ein Zensor von oben mittlerweile gar nicht mehr benötigt?
Einen Zensor braucht es ganz gewiss nicht. Aber Selbstzensur ist selbstverständlich ein Thema. Denken Sie nur an das große Heer der freien Mitarbeiter, die ja oft in eher prekären ökonomischen Verhältnissen leben. Die werden sicher darauf achten, einen Themenvorschlag so zu formulieren, dass er Chancen hat, von den redaktionellen Schleusenwärtern durchgelassen zu werden. Ich zitiere im Buch eine Umfrage unter US-Journalisten aus dem Jahr 2000 zur Frage der Selbstzensur. Vierzig Prozent bestätigten, dass Selbstzensur eine wesentliche Rolle spiele. Solche Umfragen sind natürlich anonym. Wenn Journalisten gleichsam offiziell auf das Thema angesprochen werden, fallen die Antworten anders aus. Schon dieses Sich-bedeckt-halten bei einem für Journalisten so neuralgischen Punkt könnte man als eine Form der Selbstzensur deuten. Warum reden sie nicht offen darüber, oder schlagen Alarm, wenn so etwas passiert? Mein Eindruck ist: Im breiten mittleren Streifen des Journalismus tummeln sich viele Leute, die angepasst sind, opportunistisch, konformistisch, karrieristisch – oder einfach naiv, manchmal auch schlicht inkompetent. Und das ist immer in gewisser Weise mit Selbstzensur verbunden. Nehmen wir das Beispiel Narrative: Dass die Politik Narrative in die Welt setzt, kann ich verstehen; da geht es um handfeste Interessen, Politik ist kein Oberseminar. Aber dass Journalisten solche Narrative bedienen, halte ich für absolut inakzeptabel und indiskutabel. Ein Journalismus, der sich Narrativen fügt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Und er kann schlimme Folgen haben. Hätten sich britische und amerikanische Journalisten im Vorfeld des Irak-Krieges 2003 nicht dem „Saddam-muss-weg“-Narrativ verschrieben, wären sie vielleicht eher bereit gewesen, die unzähligen Lügen von Bush, Blair & Co. einer professionellen Überprüfung zu unterziehen. Aber natürlich erfordert es Courage, sich einem dominanten Narrativ zu widersetzen – womit wir wieder beim Thema Selbstzensur wären.
Manche Medienvertreter verteidigen sich gegen den Vorwurf, die Presse sei „gelenkt“, indem sie erklären, niemand mache Ihnen Vorgaben und sie dürften alles frei recherchieren und veröffentlichen. In Ihrem Buch zitieren Sie den ehemaligen „New York Times“-Journalisten Chris Hedges, der in diesem Zusammenhang von einem „Mythos“ spricht und sagt: „In Wirklichkeit gibt es sehr enge Vorgaben, vor allem bei Themen der nationalen Sicherheit. Ich war 15 Jahre lang bei der New York Times. Die offizielle Linie der Times lautet: Wir werden niemanden vor den Kopf stoßen, von dem wir abhängig sind. Wir brauchen das Geld von den Werbekunden und den Zugang zu den Mächtigen. Man kann sie ab und zu ärgern, sollte das aber nicht zur Gewohnheit werden lassen.´“ Sehen Sie eine solche Linie auch bei deutschen Leitmedien?
Entscheidend in dem Hedges-Zitat ist der letzte Halbsatz: „…man sollte es nicht zur Gewohnheit werden lassen“. Will im Ernst jemand behaupten, die deutschen Leitmedien hätten es sich „zur Gewohnheit“ gemacht, die politisch und wirtschaftlich Mächtigen zu ärgern? Bei allem Respekt, aber da ist ja wohl das genaue Gegenteil der Fall.
Sie sind selbst als professioneller Journalist für Leitmedien tätig, unter anderem für den SWR. Sie schreiben, dass Sie persönlich in Ihrer Arbeit nie beschränkt worden sind und sie deuten an, dass Beschränkungen oder Vorgaben auch etwas mit der Reichweite des jeweiligen Mediums zu tun haben. Wer vor einem Millionenpublikum die Tagespolitik im Fernsehen kommentiert, der habe viel weniger Spielraum für „Abweichendes“ als ein Feuilleton-Redakteur beim Radio. Haben Sie bei Ihrer Arbeit von konkreten Beschränkungen bei Kollegen erfahren?
Davon hört man gelegentlich, natürlich nur „hinter vorgehaltener Hand“ oder „im Vertrauen“. Aber ich glaube, sehr oft gibt es so etwas nicht. Viele verhalten sich einfach so geschmeidig, dass es gar nicht erst so weit kommt. Sie testen die Grenzen nicht aus. Und wenn sie es versuchen, stoßen sie sehr schnell an eben jene Grenzen. Typisch für den Arbeitsalltag vieler Journalisten ist da wohl ein Fall, von dem ich neulich gehört habe: In der Redaktionskonferenz einer Radiowelle hat ein Kollege ein schwieriges, unangenehmes Thema vorgeschlagen. Und das wurde dann von der Redaktionsleitung mit dem Argument abgebügelt: „Ach, das zieht unsere Hörer nur runter. Wir wollen doch lieber eine positive Stimmung verbreiten.“ Und der Rest der Kollegen hat genickt – womit das Thema vom Tisch war. Im Hintergrund solcher Phänomene steht natürlich die „Quote“, die man zu steigern hofft, indem man möglichst gefälligen Journalismus macht. Das ist im Fernsehen noch viel ausgeprägter. Da stehen die jeweiligen Quoten ja schon kurz nach den Sendungen zur Verfügung; im Hörfunk gibt es die Media-Analyse, die Auskunft über die Reichweite der Programme gibt, nur zweimal pro Jahr.
Wie reagieren Kollegen im Mainstream eigentlich auf Ihre Recherchen und Schlussfolgerungen? Gibt es da Rückmeldungen?
Da muss ich etwas vorausschicken. Ich spreche in dem Buch zwar zunächst generell von Mainstream, führe dann aber eine wichtige Unterscheidung ein: Da ist zum einen der „Mainstream innerhalb des Mainstreams“, der eigentliche Gegenstand des Buches und der Kritik; er bildet das dominante Segment und ist weiter auf dem Vormarsch. Daneben gibt es aber auch einen „Mainstream außerhalb des Mainstreams“, ein minoritäres Segment; es befindet eher auf dem Rückzug und muss aufpassen, dass es nicht völlig an die Wand gedrückt wird. Dieses minoritäre Segment hat insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, etwa in den Kulturwellen des Hörfunks oder auch in TV-Programmen wie Arte, noch seinen Platz. Die Kolleginnen und Kollegen dieses minoritären Segments sind – natürlich neben den zunehmend kritischen Rezipienten – die Hauptzielgruppe des Buches. Der „Mainstream außerhalb des Mainstreams“ leidet besonders unter allzu pauschaler Medienkritik à la Lügenpresse, weil er sich kaum etwas hat zuschulden kommen lassen und nun für das mit in Haft genommen wird, was andere „verbrochen“ haben. Es wäre schön, wenn die Medienkritik da differenzieren und präziser argumentieren würde; und noch schöner wäre es, wenn die Kollegen im „Mainstream außerhalb des Mainstreams“ sich als Gruppe begreifen würden, die erkennt, dass sie solch differenzierte Medienkritik auf die eigenen Mühlen lenken könnte. Um auf die Frage zurückzukommen: Es gab in Zusammenhang mit dem Buch jetzt doch eine ganze Reihe von Interviewanfragen aus den Kulturprogrammen des ARD-Hörfunks. Das hat mich ein wenig überrascht, aber sehr gefreut. Vielleicht tut sich da ja etwas?
Haben Sie auch „Alpha-Journalisten“, also führende Köpfe bei den großen Zeitungen und TV-Sendern, direkt mit Ihren Thesen konfrontiert?
Alpha-Journalisten sind zwar eines meiner Themen, aber sie sind ganz gewiss nicht meine Zielgruppe. Ich berichte im Buch zwar von einem sehr interessanten Gespräch, das ich mit einem von ihnen – in einem ganz anderen Zusammenhang – Mitte der 1990er Jahre geführt habe, aber speziell für dieses Buch habe ich niemanden angesprochen. Ich fürchte, das wäre auch nicht sonderlich ergiebig. Man kommt da mit Argumenten oder Diskursbemühungen nicht viel weiter, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass viele dieser Leute ein mir sehr fremdes Journalismus-Verständnis haben. Die werden allenfalls reagieren, wenn der Druck sich weiter deutlich erhöht – aber dann ist es möglicherweise eh zu spät.
Neben dem Vorwurf der „Lückenpresse“, also dass Dinge absichtlich ausgelassen und verschwiegen werden, sprechen Sie immer wieder auch von „doppelten Standards“ in der Einordnung von Nachrichten, etwa im Zusammenhang mit Berichten zu Russland. Können Sie das kurz ausführen?
Die „doppelten Standards“ sind ein Teil des Lückenphänomens und hängen eng mit den anderen Aspekten zusammen, der Akzent liegt aber mehr auf der Bewertung. Wenn man das Vorgehen Russlands auf der Krim als „völkerrechtswidrig“ klassifiziert – was man natürlich tun kann –, aber die völkerrechtliche Dimension bei den Kriegen im Nahen und Mittleren Osten komplett ausblendet, ist das natürlich ein doppelter Standard. Da ließen sich die einschlägigen Beispiele beinah beliebig vermehren.
Haben Sie den Eindruck, dass solche doppelten Standards den Journalisten, die sie anwenden, selbst bewusst sind? Oder ist das eher ein unreflektiertes „Mitschwimmen im Strom“?
Das hängt wiederum davon ab, wo ein Journalist in der Hierarchie steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alpha-Journalisten, denen ich ja ein gewisses strategisches Denkvermögen attestiere, so etwas unbewusst machen. Bei vielen anderen Journalisten glaube ich aber schon, dass sie das einfach nicht reflektieren. Nehmen wir den Mord an Boris Nemtzow. Den Namen Nemtzow kennt natürlich inzwischen jeder deutsche Journalist. Wenn Sie hingegen nach Oles Buzina fragen, herrscht totale Unkenntnis. Oles Buzina war ein bekannter ukrainischer Journalist, ein Kritiker des neuen Regimes in Kiew; er wurde wenige Wochen nach Nemtzow ermordet, und im fraglichen Zeitraum gab es ein Dutzend Morde und mysteriöse Selbstmorde dieser Art in der Ukraine. Ich habe viele Kollegen darauf angesprochen – und immer nur große Augen gesehen. Sie wissen einfach nichts davon. Manchmal frage ich mich, wo und wie diese Leute sich eigentlich informieren.
Stichwort Bewusstsein: Verstehen die Verantwortlichen in den Medien Ihrer Einschätzung nach den Kern der Kritik und des allgemeinen Misstrauens? Wenn man sich umhört, begegnet einem viel Ratlosigkeit und Unverständnis in der Branche. Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass Kollegen sich in einer Blase aus weitgehend konformen Einschätzungen bewegen und kaum noch in der Lage sind, diese Sphäre geistig zu verlassen, um sie einmal von außen zu betrachten. Täuscht das?
Es gibt in Großbritannien zwei durchaus renommierte Medienkritiker, David Cromwell und David Edwards. Sie betreiben die Website „Medialens“, haben aber auch medienkritische Bücher publiziert. Die beiden versuchen immer wieder, Journalisten direkt mit ihrer Kritik zu konfrontierten und ins Gespräch zu kommen. Mitunter gelingt ihnen das, aber allzu oft machen sie auch negative Erfahrungen: Auf ihre E-Mails bekommen sie keine Antwort, oder die kontaktierten Journalisten brechen die Debatten einfach ab, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Aus Deutschland ist mir vor ein paar Tagen ein E-Mail-Wechsel zwischen einem kritischen Rezipienten und dem verantwortlichen Redakteur einer großen Zeitung bekannt geworden. Zwischen den beiden ging es ein paarmal hin und her, und dann beendete der Journalist das Ganze mit dem Hinweis, es gebe doch eine elegante Lösung des Problems: Die Rezipient solle einfach seine Kommentare und Artikel nicht mehr lesen. Mich macht so eine Selbstgefälligkeit sprachlos.
Sie sprechen im Buch von einem „systemischen Problem“ bei den Medien. Was muss sich Ihrer Ansicht nach grundsätzlich ändern?
Das systemische Problem besteht in den medialen Besitz- und Kontrollverhältnissen. Und da gibt es im Mainstream doch eigentlich nur drei große Varianten: privatwirtschaftliche, staatliche und öffentlich-rechtliche Organisationsformen. Welche bietet die besten Voraussetzungen für integren, unabhängigen Journalismus? Die staatliche? Wohl eher nicht. Die privatwirtschaftliche? Man bedenke, dass sich in den USA Anfang der 1980er Jahre noch fünfzig Unternehmen den Medienmarkt teilten und es heute nur noch sechs Mega-Konzerne sind. Und in vielen anderen Ländern sieht es auch nicht wesentlich besser aus. Würden wir in ruhigen, stabilen Zeiten leben, wäre das vielleicht alles noch verkraftbar. Aber in einer Krisen-Epoche wie gegenwärtig –und die Krisen werden uns auf absehbare Zeit erhalten bleiben –, machen sich diese Besitz- und Kontrollverhältnisse in den Mainstreammedien sehr viel deutlicher bemerkbar. Wenn die Polarisierung zunimmt, positioniert sich der Mainstream aufseiten der etablierten Ordnung. Aus Mainstreammedien werden Establishment-Medien. Um dieses Problem der Besitz- und Kontrollstrukturen machen Journalisten gerne einen großen Bogen, weil sie sich dann zwei Fragen stellen müssten: Kann ich, wenn ich zum Beispiel in einem großen Medienkonzern arbeite, eigentlich integren, unabhängigen Journalismus betreiben? Und wenn ich schon dort arbeite, warum gerate ich mit diesen Strukturen nicht viel öfter in Konflikt?
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.
In einem Interview sagten Sie jüngst: „Wir bräuchten ein reformiertes öffentlich-rechtliches System aus Print- und elektronischen Medien, das der Gesellschaft gehört und das alle Gruppen abbildet. Es müsste unabhängig sein, also ohne Werbung, Parteieneinfluss und Staatsnähe.“ Könnten Sie diese Vision etwas näher erläutern? Gibt es Vorbilder dafür?
Die öffentlich-rechtliche Organisationsform von Medien war ja gedacht als „dritter Weg“ zwischen kommerziellen und staatlichen Varianten. Aber sie hat sich im Laufe der Zeit den beiden anderen Modellen angenähert, das heißt: Sie ist staats- und wirtschaftsnäher geworden, insbesondere abhängiger von Staat und Wirtschaft. Und sie muss sich gegenüber beiden über die „Quote“ legitimieren. Ich persönlich fände eine puristische öffentlich-rechtliche Organisationsform für viele Medien ideal, also absolut werbefrei und wirklich unabhängig von staatlichen und/oder parteipolitischen Einflüssen. Ich will Medien, die tatsächlich der Gesellschaft gehören, die sie durch ihre Gebühren finanziert – aber natürlich auch bereit sein müsste, das zu tun. Der emphatische Anspruch vieler Journalisten „Wir sind die vierte Gewalt!“ lässt sich eigentlich nur auf diesem Weg realisieren. Jörg Schönenborn hat ja mal gesagt, die Rundfunkgebühr sei eine „Demokratieabgabe“. Dafür hat er viel Kritik und Häme einstecken müssen, weil zwischen Anspruch und Wirklichkeit eben eine große Diskrepanz besteht. Aber im Prinzip hat er Recht. So könnte es tatsächlich sein. Aber das ist gegenwärtig reine Utopie. Was man konkret tun kann, ist Folgendes: Erstens müssen wir Medienkritik präzise, differenziert und in seriöser Form vortragen. Zweitens müssen wir – Medienkritiker wie Journalisten – die noch verbliebenen Refugien des integren, „nach bestem Wissen und Gewissen“ arbeitenden Journalismus mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und schließlich, drittens, müssen wir Alternativmedien unterstützen. Von denen gibt es – im Internetzeitalter – immer mehr, und in manchen Ländern, etwa den USA oder auch Großbritannien, bilden sie bereits eine echte Macht. Wenn sich der Mainstream innerhalb des Mainstreams nicht ändert – und dafür gibt es keine Anzeichen, im Gegenteil –, können Alternativmedien eigentlich nur an Terrain gewinnen.