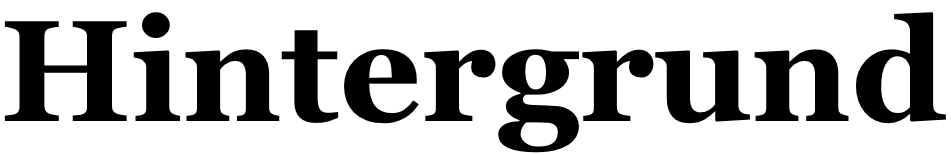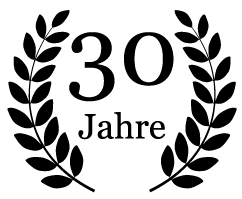Kein Linksruck bei der Linken
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Ein Kommentar von Heiner Feyerabend, 5. Juni 2012 –
Die „Chaostage“ (dpa) in Göttingen sind vorüber: Der Bundesparteitag der Linken endete nicht mit einer Spaltung der Partei, sondern – so zumindest der Tenor Deutschlands führender Medien – mit einem Linksruck.
Gewählt wurden der gewerkschaftsnahe baden-württembergische Landeschef Bernd Riexinger (56) und die bisherige stellvertretende Parteivorsitzende Katja Kipping (34), die aus dem Landesverband Sachsen kommt. Die Stellvertreter des Duos sind Sarah Wagenknecht, Axel Troost, Jan van Aken und Caren Lay.
Riexinger siegte mit 53,5 Prozent der Stimmen nur knapp über seinen Konkurrenten, den ehemaligen Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch, der 45,2 Prozent erhielt. Der aus dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern stammende Bartsch ist Protagonist der Parteirechten („Reformer“), die zugunsten einer Regierungsbeteiligung bereit sind, linke Kernforderungen („rote Haltelinien“) für umstrittene Kompromisse preiszugeben. Mit einer Politik der unterwürfigen Anbiederung gegenüber der SPD, wie sie Vertreter der Parteirechten in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern exerzierten, hat die Bartsch-Fraktion praktisch-pragmatisch unter Beweis gestellt, was von ihr im Falle einer Machtbeteiligung nicht zu erwarten ist: Eine linke antineoliberale Politik.
Somit nimmt es nicht Wunder, dass Bartsch zum Hätschelkind jener Kräfte avanciert ist, die die Linke, wenn nicht am Boden, so doch zumindest geläutert im Sinne einer Regierungsfähigkeit sehen wollen, wie sie von den potentiellen rot-grünen Koalitionspartnern definiert wird.
Dialektik des Lobes
Wenn die konservative FAZ, um nur eine Zeitung unter vielen aus dem deutschen Blätterwald zu zitieren, sorgenvoll davor warnt, „dass eine Lafontaine-Linke im Bund nicht koalitions- und damit regierungsfähig ist“, so muss gefragt werden, warum das „Kampfblatt der Bourgeoisie“ (Jutta Ditfurth) ein Interesse daran hat, Linke in der Regierung sitzen zu sehen. Wohl kaum, weil sie einen nachhaltigen Politikwechsel herbeisehnt. Die Rolle, die einer Bartsch-Linken zufallen soll, wäre jene, potentiellen Protest und Widerstand mittels linker Bekenntnisse, denen aber keine Taten folgen, in das neoliberale Projekt einzubinden. Die sich beschleunigenden sozialpolitischen Verwerfungen in Europa machen die inhaltliche Neutralisierung der Linkspartei für den neoliberalen Machtblock umso dringlicher.
Es sollte den Bartsch-Anhängern zu denken geben, wenn führende SPD-Politiker, wie Wolfgang Thierse oder Bartschs Duz-Freund Sigmar Gabriel, voll des Lobes für ihren Genossen bei der Linken sind. Schließlich erklärt die SPD seit Jahren, ihr Ziel sei die Marginalisierung der Linken. Wer so viel Zuspruch von seinem Gegner erfährt, der sollte sich die Frage stellen, ob sein politischer Kompass richtig justiert ist – es sei denn, er will dem Gegner dienen.
Mediales Messerwetzen
Warum Lafontaine hingegen das Feindbild Nummer eins der Konzernmedien ist, liegt auf der Hand: Als prominentestes Aushängeschild der Linken erscheint der Saarländer am ehesten geeignet, den negativen Trend bei den Wahlen umzukehren und den Wiedereinzug in den Bundestag 2013 zu sichern. Und zwar den Einzug einer Linken, die sich der „neoliberalen Konsenssoße“ (1) verweigert. 1999 wurde Lafontaine von der britischen Boulevardzeitung The Sun für seine kompromisslose Kritik der Dominanz der Finanzmärkte zum „gefährlichsten Mann Europas“ gekürt. Als damaliger Wirtschaftsminister genoss er in der SPD aber nicht genug Rückhalt, um die Finanzmärkte an die Kette zu legen – er trat daraufhin zurück.
Gegenwärtig treibt diese Dominanz der Finanzmärkte, wie von Lafontaine prognostiziert, Europa in den Abgrund – zumindest was soziale und demokratische Standards anbelangt. Wenn jemand von der Geschichte so sehr Recht bekommt, dann ist er besonders gefährlich für diejenigen, die für einen Posten in der Regierung bereit sind, mit jenen Parteien zu koalieren – ohne von ihnen einen Bruch mit der bisherigen Politik zu verlangen –, die diese (neoliberale) Geschichte maßgeblich zu verantworten haben..
Nach der Ankündigung seiner möglichen Parteivorsitz-Kandidatur gingen Spiegel, Welt, stern & Co dann auch in die Vollen und bemühten die ganze Begriffspalette, mit der Lafontaine als eigennütziger, eitler Machtmensch dargestellt werden sollte. Er, „Sonnenkönig“ und „Napoleon von der Saar“, die „Diva“ und „Primadonna“, sei ein „großer Krakeeler“ und „penetranter Besserwisser“ mit „Macho-Allüren“, der „auf Krawall“ mache und sich „per Akklamation“ zum Vorsitzenden befördern lassen wolle und die Linke spalte. Bartsch hingegen erntete allenthalben Lob von eben jenen Medien, die sonst Die Linke bei jedem Anlass in der Luft zerreißen. Ob die sogenannte Antisemitismus-Debatte, der „Mauer-Streit“, ein Brief an Fidel Castro, das Wort „Kommunismus“ im Munde der Parteivorsitzenden, die vermeintliche Solidarität mit den „Schlächtern“ von Teheran und Damaskus – stets malten die Konzernmedien mit einer gewissen Genüsslichkeit das Bild einer zerstrittenen Linken, in der einerseits Radikalinskis und Fundamentalisten die Partei in den Abgrund treiben würden, während der rechte Flügel („Reformer“) als vernünftig und „geerdet“ dargestellt wurde. Und stets nährten die Vertreter des rechten Flügels diese Darstellung , trotz des Image-Schadens, den sie für die Partei bedeutet.
Insbesondere wurde Lafontaine – sowohl von der Parteirechten als auch von den Konzernmedien – verübelt, seine Kandidatur zum Vorsitzenden an einen Rückzug Bartschs geknüpft zu haben. Als Bedingung für seine Rückkehr hatte Lafontaine verlangt, dass eine Mehrheit in der Partei ihn als Vorsitzenden wolle und „sich eine Führung zusammenfindet, die loyal miteinander arbeitet“.
Albrecht Müller, Mitbetreiber des Internetportals NachDenkSeiten und ehemaliger Wahlkampfleiter der SPD unter Willi Brandt und Helmut Schmidt, schrieb dazu: „Die Kampagne zu den aktuellen Überlegungen und Forderungen Lafontaines die Parteispitze betreffend ist erkennbar abgesprochen und gleichgeschaltet und hat mit rationalen Überlegungen nichts mehr zu tun. Dass Parteivorsitzende und Spitzenkandidaten nicht in Kampfabstimmungen bestimmt werden wollen, ist das Selbstverständlichste von der Welt. Auch dass Parteivorsitzende und ihre nächsten Mitarbeiter, die Bundesgeschäftsführer bzw. Generalsekretäre, auf einer Welle funken müssen, braucht im Blick auf andere Parteien nicht erläutert zu werden. Lafontaine kreidet man diesen selbstverständlichen Wunsch an. Absurd.“ (2)
Auch wenn der Wunsch selbstverständlich erscheinen mag, vor dem Hintergrund der innerparteilich existierenden Gräben war es ein Fehler von Lafontaine, auf den Rückzug seines Kontrahenten bestanden zu haben. Schließlich ist Bartsch der Wunschkandidat der Ostverbände, die nicht nur die Mehrheit der Mitglieder stellen, sondern auch 75 von 76 hauptamtlichen Amtsrägern der Partei.
Es ist verständlich, wenn die Ostverbände ihrem innerparteilichen Machtübergewicht entsprechend nicht auf die Kandidatur von jemandem „aus ihren Reihen“ verzichten wollen. Unverständlich ist hingegen die aggressive Art und Weise, in der namhafte Funktionäre der Bartsch-Fraktion Wasser auf die Mühlen der Medienkampagne gossen, die die Demontage des ehemaligen Parteichefs zum Zweck hatte Sie sprachen von „Erpressungsversuchen“ eines „Heilsbringers“, der nicht mehr zu „recyclen“ sei.
Lafontaines Erwägung einer Kandidatur war schließlich nicht persönlichen Machtambitionen geschuldet, sondern dem Drängen vieler Parteimitglieder. Als die Frage „Lafontaine oder Bartsch“ auf einer Sitzung des Geschäftsführenden Parteivorstandes im Vorfeld des Parteitages diskutiert wurde, erwies sich Lafontaine nicht als jemand, der auf Teufel komm raus nach dem Posten des Vorsitzenden strebt. Zumindest hat Bartsch ihn so nicht erlebt: „Es war eine kulturvolle Diskussion und nicht das große Messerwetzen, mit dem manche, insbesondere außerhalb der Linken, gerechnet hatten. Oskar Lafontaine hat nicht, wie vorher in Medien zu lesen war, alle seine Bedingungen dargelegt, sondern seine eigene Kandidatur für den Parteivorsitz angeboten. Er würde noch einmal bereitstehen, wenn die Partei es will und wenn es keine Alternativkandidatur gibt. Er war klar in der Positionierung und hat einen aus seiner Sicht großen Unterschied klar gemacht: Dietmar will es werden und ich nicht unbedingt, hat er gesagt“, beschrieb Bartsch die Atmosphäre der Sitzung . (3)
Nachdem der nötige innerparteiliche Rückenwind ausblieb, zog Lafontaine seine Kandidatur folgerichtig zurück. Die Medien nahmen sodann Sarah Wagenknecht ins Visier, da sie nun die aussichtsreichste Kandidatin der Parteilinken für das Amt der Vorsitzenden war. Auch die „Wiedergängerin Margot Honeckers“ (FAZ), die nebenbei von Spiegel-Online zur Saarländerin erklärt wurde, (4) stieß auf heftige Ablehnung der sogenannten Reformer.
Die von Gregor Gysi auf dem Parteitag ausgesprochene Drohung mit der Spaltung der Partei für den Fall, dass keine „kooperative Führung“ zustande komme, musste als Druckmittel gegen Wagenknecht verstanden werden, auf eine eigene Kandidatur zu verzichten. Das tat sie dann auch mit dem Hinweis, sie wolle einen „Showdown“ vermeiden.
Showdown
Der Showdown fand dennoch statt. Wenn Lafontaine mit seinem Rückzug eine Kampfabstimmung vermeiden wollte, so war diesem Vorhaben kein Erfolg beschieden. Im Gegenteil, die am Samstag erfolgte Wahl zum Parteivorsitz hatte noch viel mehr den Charakter einer Kampfabstimmung, als wenn der Ex-SPD-Vorsitzende selbst zur Wahl gestanden hätte. Denn Riexinger hatte bis vor wenigen Wochen noch niemand auf dem Zettel. Die Vermutung liegt daher nahe, dass eine Stimme für ihn in erster Linie eine Stimme gegen Bartsch war. Eine Stimme für Lafontaine wäre hingegen in erster Linie eine Stimme für den vermutlich besten Wahlkämpfer der Partei gewesen, mit dessen Namen das herausragende Ergebnis bei der Bundestagswahl 2009 maßgeblich verbunden ist. Und nur in zweiter Linie wäre es eine Stimme gegen Bartsch gewesen.
Die Wahl Riexingers muss also vor allem als Nicht-Wahl von Dietmar Bartsch interpretiert werden. Mit diesem Vorgehen dürfte die Lafontaine-Fraktion nicht zur allseits beschworenen Überwindung der Parteigräben beigetragen haben.
Diese Gräben weiter zu vertiefen, ist offenbar das Anliegen jener Medien, die Bartsch an die Spitze der Linken schreiben wollten. Lafontaine habe Riexinger „durchgeboxt“ (Focus-Online), dessen Wahl sei „Lafontaines Rache“, so der Spiegel, der Bartsch zum „Märtyrer“ stilisierte, der „den Ossis das Selbstbewusstsein vorgelebt (hat), mit dem man sich auch beim Preis des eigenen Untergangs einem wie Lafontaine nicht mehr unterwirft“. (5)
Kein Linksruck
Der Interpretation der Medien folgend, gemäß der es auf dem Parteitag zu einem Linksruck kam, beschwören Parteigänger der politischen Konkurrenz nun zum gefühlten tausendsten Mal die vermeintliche Regierungsunfähigkeit der Linken.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, sprach der Linken die bundespolitische Kompetenz ab. „Die Partei hat sich als politikunfähig gezeigt. Eine solche Partei braucht Deutschland nicht“, so Oppermann.
Ähnlich schätzt Oppermanns grüner Kollege Volker Beck die Situation ein: „Auf dem Parteitag hat der Lafontaine-Flügel triumphiert, die bundespolitische Bedeutung der Partei befindet sich im Sinkflug.“ Die Linke sei mit ihrer neuen Führung „nicht unbedingt anschlussfähiger“ geworden, so Beck.
Doch von einem Linksruck der Parteiführung kann nicht die Rede sein. Im Bundesvorstand sind Vertreter beider Flügel vertreten. Ebenso verhält es sich bei den Stellvertretern der Vorsitzenden. Die Posten des Bundesgeschäftsführers und des Schatzmeisters gingen an Exponenten der Parteirechten.
Riexinger steht weniger für einen Linksruck als vielmehr für die Kontinuität der Position des ehemaligen Vorsitzenden Klaus Ernst, der ebenso dem Gewerkschaftsflügel entstammt. In Hinblick auf die Wahl von Katja Kipping muss dagegen eher von einem Rechtsruck gesprochen werden.
Katja Kipping – das Ausnahmetalent
Auffällig ist eine Gemeinsamkeit, die die neue Vorsitzende mit Bartsch hat: Die Konzernmedien belegen sie beinahe durchweg mit positiven Attributen. Sie sei das „größte Nachwuchstalent“ (stern) der Partei und deren „letzte Chance“ (n-tv), eine „Ausnahmeerscheinung“ (FAZ). Sie besitze „Ausstrahlung, Talent und Willen“ (Spiegel) und sei die einzige, „die zumindest für einen Hauch mehr Aufregung und Neugier für die Partei sorgen könnte“ und im Gegensatz zu Sarah Wagenknecht „im 21. Jahrhundert lebt“ (Welt).
Kipping trat 1998 im Alter von 20 Jahren der PDS bei und legte fortan eine „Bilderbuchkarriere“ (n-tv) hin: Nur fünf Jahre später war sie bereits stellvertretende Bundesvorsitzende.
Während Vertreter der Piratenpartei meist mit Spott und Häme für ihre „unreife“ Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen überzogen werden, tut es den medialen Sympathiebekundungen im Falle Kippings keinen Abbruch, dass sie in der Linken eine der stärksten Befürworterin eines solchen ist.
Anerkennung erntet Kipping nicht nur von den Medien. Auch der damalige Gesandte der rechten israelischen Regierung in Deutschland, Ilan Mor, lobte im Juli 2009 die aufstrebende Politikerin mit den Worten, sie verkörpere u.a. neben Gregor Gysi eine „neue Generation“. Er habe „die Aufgabe, den Kontakt mit diesen Leuten zu halten, persönlich übernommen“, so Mor. (6)
Der neokonservative Henryk M. Broder nannte Kipping eine „kluge und angenehme Person“ und bescheinigte ihr Glaubwürdigkeit. (7) Der Grund, warum der von der Süddeutschen Zeitung als „Hassprediger“ titulierte Broder, den Gregor Gysi als „lieber Henryk“ anzureden pflegt (7), an Kipping verbale Lorbeeren verteilt, ist in deren – zumindest außenpolitischer – Nähe zu sogenannten antideutschen Positionen zu suchen.
Im Oktober 2006, kurz nach dem Krieg Israels gegen seinen Nachbarn Libanon, warb sie in einem Text für die Abkehr von antiimperialistischen Positionen. Stattdessen sollte die Linke das „Existenzrecht“ Israels „bedingungslos anerkennen“. (9) Die von Kipping und anderen betriebene proisraelische Lobbyarbeit trug Früchte: Zwei Jahre später erklärte Gysi die „Solidarität mit Israel“ zur „deutschen Staatsräson“. Damit befindet er sich nicht nur auf einer Linie mit der Außenpolitik der Bundesregierung, er habe sich dadurch auch „Freunde beim BAK Shalom gemacht hat“, schrieb damals der stern in einem Artikel unter der aus heutiger Sicht interessanten Zwischenüberschrift: „Gysi und Kipping – gegen Lafontaine“. (10)
Der Bundesarbeitskreis Shalom der Linksjugend kann als neokonservatives U-Boot innerhalb der Linkspartei bezeichnet werden. Hintergrund berichtete bereits vor zwei Jahren ausführlich über den Zusammenschluss, der für die bedingungslose Solidarität mit der israelischen Politik und der – verhohlenen – Unterstützung der Kriege der USA steht. Hochrangige Vertreter der Partei zählen zu den Förderern des Arbeitskreises, der 2007 vor allem aus der Jungen Linken (JL) Sachsen hervorgegangen war. (11)
Die von den „Antideutschen“ beherrschte JL Sachsen wurde maßgeblich von Kipping und dem BAK Shalom-Gründungsmitglied und Bundestagsabgeordneten Michael Leutert aufgebaut. Beide haben sich „einen Ruf als Verfechter ‚antideutscher‘ Positionen in der Linksfraktion im Bundestag erarbeitet“, schrieb die junge Welt. (12)
Gerne inszeniert sich Kipping als Vermittlerin zwischen den verschiedenen Partei-Flügeln. Im Vorfeld des Parteitages übernahmen Medien ihre Darstellung, sie symbolisiere einen „dritten Weg“.
Doch dem ist nicht so. Die von ihr mitbegründete AG Emanzipatorische Linke (EmaLi) steht dem parteirechten Forum Demokratischer Sozialismus (FDS) nahe. Der von der EmaLi geführte Diskurs nimmt sich zuweilen wie eine weichgespülte Variante der Positionen des BAK Shalom aus.
Der Journalist Peter Nowak schrieb über die EmaLi: „So könnte man den BAK Shalom als junge Wilde betrachten, die ihre Anliegen ohne wenig verbands- und parteiinterne Rücksichtnahme vertreten, während die schon gesetzteren Vertreter der emanzipatorischen Linken die Thesen dann geglätteter und parteiverträglicher in konkrete Politik umsetzen.“ (13)
Kipping ist zudem Mitbegründerin des Instituts Solidarische Moderne, in dem sich Mitglieder von SPD, Grünen und Linke zusammengeschlossen haben, um für eine rot-rot-grüne Koalition zu werben. Ein Abgrenzungskurs zu den „Hartz IV“-Parteien, wie ihn die Parteilinke einfordert, ist von der neuen Vorsitzenden daher nicht zu erwarten.
Und nicht zu vergessen: Die EmaLi bekundete ihre Solidarität mit Bartsch, nachdem dieser aufgrund der ihm vorgeworfenen Illoyalität – er soll Interna an den Spiegel ausgeplaudert haben – vom Posten des Bundesgeschäftsführers zurücktreten musste. Und ob es im Einklang mit links-emanzipatorischen Idealen steht, sich für eine Sarkozy-Anhängerin und Kriegsbefürworterin als Bundespräsidentin einzusetzen, wie es die EmaLi getan hat, als sie sich für die Kandidatur von Beate Klarsfeld einsetzte, ist äußerst fraglich. (14) Es sei denn, „Emanzipatorische Linke“ stünde für die Emanzipation von linken Positionen.
Sicher ist: Einen Linksruck hat es nicht gegeben, eher ist von der Linken mit Katja Kipping an der Spitze eine Annäherung an Rot-Grün zu erwarten. Die dabei alles entscheidende Frage wird sein, ob eine solche Annäherung auf Kosten der Einhaltung der „roten Haltelinien“ erfolgt, die im Erfurter Programm von einer überwältigenden Mehrheit beschlossen wurden. In ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz versicherte Kipping, dieses Programm zum Maßstab ihres Handelns zu machen. An diesem Versprechen wird sie sich zukünftig messen lassen müssen.
Anmerkungen
(1) Den Begriff verwendete Dietmar Bartsch kürzlich in einem Beitrag für die Financial Times Deutschland im folgenden Zusammenhang: „Deshalb werbe ich dafür, uns nicht länger über den Verrat der SPD an den eigenen Traditionen zu definieren und auch nicht über die Abgrenzung von der „neoliberalen Konsenssoße“.“
http://www.dietmar-bartsch.de/o-ton/items/eigenstaendig-und-durchsetzungsfaehig.html
(2) http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=13317
(3) http://www.freitag.de/politik/1220–1
(4) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kommentar-zur-krise-der-linken-gysi-ist-der-gewinner-a-836686.html
(5) ebd.
(6) http://jungle-world.com/artikel/2009/30/35908.html
(7) http://www.digberlin.de/die-transformation-des-interesses-an-den-juden/
(8) http://www.jungewelt.de/2006/11-03/020.php
(9) http://www.katja-kipping.de/article/452.jenseits-von-antizionismus-und-antideutschen-zuspitzungen.html
(10) http://www.stern.de/politik/deutschland/linkspartei-ein-problem-namens-israel-621412.html
(11) Siehe: http://www.hintergrund.de/20100317759/politik/inland/die-linke-von-innen-umzingelt.html
(12) http://www.jungewelt.de/2007/04-17/044.php
(13) http://www.heise.de/tp/artikel/28/28145/1.html
(14) Siehe: http://www.hintergrund.de/201202281943/politik/inland/offenbarungseid-die-linke-und-die-wahl-des-bundespraesidenten.html