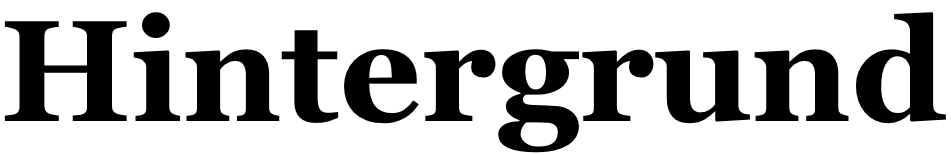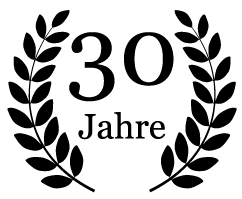„Immer nur von Europa sprechen“
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Zur Geschichte und Gegenwart des deutschen Großmachtstrebens –
Von THOMAS EIPELDAUER, 10. April 2013 –
Wir erleben heute ein „ein europäisches Deutschland in einem deutschen Europa“, schrieb Timothy Garton Ash in einem Debattenbeitrag für den Spiegel im Februar 2012. Die Formulierung des britischen Historikers hat einiges für sich: Ein „europäisches Deutschland“, weil die wirkmächtigsten Kreise aus Industrie, Banken und Politik der Bundesrepublik eine klar auf europäische Integration im Rahmen der EU ausgerichtete Strategie verfolgen. Und ein „deutsches Europa“, weil es ebendenselben Kreisen außerordentlich gut gelingt, ihre Ziele für die gesamte Europäische Union verbindlich zu machen.
| Endlich europäische Hegemonialmacht: Im Gefolge der Krise ist die Realisierung eines traditionsreichen Projekts der deutschen Eliten gelungen (Parteitag der CDU, Leipzig, 15.11.2011) |
Die Bundesrepublik sei durch die sogenannte Staatsschuldenkrise regelrecht dazu gezwungen, Europa zu „führen“, lautet ein häufig vorgebrachtes Argument. Wolfgang Ischinger, Organisator der Münchner Sicherheitskonferenz, formulierte es im Gespräch mit dem Bayernkurier (31. März 2012) auf diese Weise: „Wir haben uns ja eigentlich abgewöhnen wollen, andere zu führen. Wir haben uns so wohlgefühlt in einer Europäischen Union, in der sich die Großen etwas kleiner machen und die Kleinen sich etwas größer machen dürfen, und in der so eine durchaus funktionierende Harmonie hergestellt worden ist. Aber diese Harmonie ist zerbrochen in der Finanzkrise. Und irgendeiner muss ja nun wieder zu stabilen Verhältnissen führen, und ich fürchte, nur wir können es. Also müssen wir es jetzt auch tun. Und die deutsche politische Klasse wird sich an diese neue Führungsverantwortung gewöhnen müssen.“
Die Preußen AG
Der Gedanke, unter dem Deckmantel der Betonung gesamteuropäischen Wohlergehens durchaus „nationalen“ ökonomischen wie politischen Zielen Geltung zu verschaffen, ist indes hierzulande nicht neu. Im Spätsommer 1914 – der Erste Weltkrieg hatte eben begonnen – da war in der als „Septemberprogramm“ bekannt gewordenen Kriegszielschrift des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg die Rede von der „Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen, unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich-Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen“. Ein solcher Verband – „unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung“ – könne dazu beitragen, „die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa zu stabilisieren“.
Wie man sich das in der Chefetage des Kaiserreichs vorstellte, kann man einer Notiz Kurt Riezlers, eines engen Mitarbeiters Bethmann Hollwegs, entnehmen. Der vertraute am 18. Mai 1915 seinem Tagebuch an, wie er sich die „europäische Verbrämung unseres Machtwillens“ dachte: „Das mitteleuropäische Reich Deutscher Nation. Das bei Aktiengesellschaften übliche Schachtelsystem, das Deutsche Reich eine AG mit preußischer Aktienmajorität, jede Hinzunahme neuer Aktionäre würde diese Mehrheit, auf der (…) das Reich steht, zerstören. Daher um das Deutsche Reich herum ein Staatenbund, in dem das Reich ebenso die Majorität hat wie Preußen im Reich – daher denn Preußen auch in diesem Staatenbund die tatsächliche Leitung hat.“ So brauche man gar nicht „von Anschluss an die Zentralmacht zu reden. Der europäische Gedanke, wenn er sich weiter denkt, führt ganz allein zu solcher Konsequenz.“ Dieses Mitteleuropa herzustellen, sei „wirtschaftlich und politisch die welthistorische Aufgabe“.
Noch stärker am Wunschzettel des heimischen Industrie- und Bankkapitals ausgerichtet, findet sich die Sehnsucht nach Deutsch-Europa auch in den Hetzschriften des „Alldeutschen Verbandes“. Man solle nun endlich alle „matten ‚Humanitätsrücksichten’“ ablegen, polterte dessen Vorsitzender Heinrich Claß im September 1914. Es sei den anderen Völkern keinerlei Rücksicht mehr entgegenzubringen, der den Feinden abzuverlangende Preis nach dem erfolgreich zu Ende geführten Waffengang habe sich „allein nach dem Bedürfnis des eigenen Volks“ zu richten und müsse den „dargebrachten Blutopfern“ angemessen sein. Dass Mitteleuropa ein großes, einheitliches Wirtschaftsgebilde darstellen werde, liege als geradezu gebieterische Forderung in der Luft.
Abendländische Mission
Doch obwohl man einiges an „Blutopfern“ darbringen ließ, wurde aus den ehrgeizigen Plänen nichts. Nach dem Friedensvertrag von Versailles, mit dem der Erste Weltkrieg im Jahr 1919 endete, mussten erst einmal kleinere Brötchen gebacken werden, als man vor der Schlacht von Verdun (1916) gedacht hatte. Die Gewissheit, in Europa eine Sonderrolle innezuhaben, ist – mit je unterschiedlicher Rechtfertigung und Ausdehnung des beanspruchten Gebietes – den Intellektuellen und Politikern der Weimarer Republik geblieben.
Und auch in der Zwischenkriegszeit verstummte der Wunsch, in „Mitteleuropa“ hegemonial zu werden, um so global eine wichtige Rolle spielen zu können, nicht. Am „engeren Zusammenschluss der europäischen Staaten“ führe kein Weg vorbei, weil europäische „Sieger wie Besiegte und Neutrale“ von „Jahr zu Jahr immer mehr vom Weltmarkt verdrängt“ werden, erläuterte der Zentrumspolitiker Johannes Bell seinen Kollegen im Reichstag im Mai 1925. Über Parteigrenzen hinweg war diese Auffassung Gemeingut. Die europäische Einheit sei anzustreben, weil „die vernünftigen Leute in allen Ländern Europas zu der Überzeugung gekommen sind, dass dieses alte Europa viel zu klein ist, um einen neuen Krieg zu führen, dass dieses alte Europa auch viel zu klein ist, den ungeheuren wirtschaftlichen Vereinigungen, die sich auf dem Boden der Vereinigten Staaten von Amerika aufgebaut haben (…), eine Konkurrenz entgegenzusetzen“, argumentierte etwa Johann Heinrich von Bernstorff von den Deutschen Demokraten in derselben Sitzungswoche vor dem Reichstag.
Eng verwoben mit den Debatten um eine herzustellende (Mittel-)Europäische Union war der Wunsch der deutschen Eliten, die Nachkriegsordnung zu revidieren. „Soll Europa seine abendländische Mission erfüllen“, bedürfe es einer „Verbannung des Geistes von Versailles“, war Johannes Bell überzeugt. Sechs Jahre später, im Februar 1931, klang das bei Ludwig Kaas, dem Vorsitzenden der Zentrumspartei, noch siegessicherer: Diejenigen, die den „Status Quo“ als unabänderlich betrachten, können „ruhig ihre Europa-Hoffnungen begraben“: „Sie werden niemals ein neues Europa aufbauen, wenn sie dem wirtschaftlichen, politischen und geographischen Herzen Europas nicht die Lebensmöglichkeiten geben wollen, die für die Gesundung des gesamten Organismus eine Selbstverständlichkeit sind.“ Zwei Jahre später stimmten Kaas und seine Partei für Hitlers „Ermächtigungsgesetz“.
Auch 1933 bildete keine absolute Zäsur, was die Europa-Pläne der deutschen Eliten anbelangt. Mit Blut und Bajonetten wurde
| NS-Propagandaplakat, um 1941 |
nun umgesetzt, was rechte Intellektuelle während der Weimarer Republik mit Tinte und Feder vorgezeichnet und sich die Herren aus Militär, Industrie und Finanz so sehnlich gewünscht hatten. Nun knüpften vor allem die Vorstellungen, die man sich für die Zeit nach dem siegreichen Friedensschluss ausmalte, an zentrale Topoi aus den nationalliberalen und rechtskonservativen Europa-Konzeptionen an. Werner Daitz, Präsident des „Führerrings“ der „Gesellschaft für europäische Wirtschaftsplanung und Großraumwirtschaft“, in der fast alle Reichsministerien vertreten waren, schrieb am 31. Mai 1940 in einer Denkschrift „betreffend Die Errichtung eines Reichskommissariats für Großraumwirtschaft“: Man habe nach dem Krieg eine „kontinentaleuropäische Großraumwirtschaft unter deutscher Führung“ zu errichten, weil nur so den „gewaltigen Wirtschaftsblöcken Nord- und Südamerikas, dem Yen-Block und dem vielleicht verbleibenden restlichen Pfund-Block erfolgreich die Stirn zu bieten“ (sei).Und er fügt hinzu: „Wir müssen grundsätzlich immer nur von Europa sprechen, denn die deutsche Führung ergibt sich ganz von selbst aus dem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, technischen Schwergewicht Deutschlands und seiner geographischen Lage.“
Ähnlich argumentierte der Ökonom Horst Jecht in der 1943 vom „Verein Berliner Kaufleute und Industrieller“ herausgegebenen Broschüre Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Der wirtschaftliche Zusammenschluss Europas, im Krieg als Schicksalsgemeinschaft bereits vorweggenommen, bleibe auch in Friedenszeiten notwendig, „weil die Entwicklung der übrigen Großwirtschaftsräume (…) Europa gar keine andere Wahl lässt“. Die Herstellung eines europäischen Großwirtschaftsraums sei unerlässlich im „Kampf gegen den Bolschewismus und Amerikanismus“. Dass bei dieser „Neuordnung Deutschland eine besondere Rolle zufällt“, liege am ökonomischen Gewicht des Reichs. Reichswirtschaftsminister Walther Funk schlug in dieselbe Kerbe: „Außerhalb Europas“ – zu dem rechnet er auch schon die „ehemals sowjetrussischen Gebiete“ – „haben sich (…) bereits riesige Wirtschaftsräume gebildet oder sind im Entstehen begriffen. Europa darf im eigenen Interesse nicht in der Rückständigkeit seiner Postkutschenromantik verharren.“
Zwei Jahre später zeigte sich allerdings, dass die Völker Europas die ihnen von „Benito Mussolini und Adolf Hitler (gegebene) Chance, wahrhaft europäisch zu werden“ (Walther Funk), nicht ergreifen wollten. Funk fand sich in Nürnberg vor Gericht, die von Horst Jecht – der lehrte bald wieder in Göttingen – wacker gehaltene Front gegen den „Amerikanismus“ musste geräumt werden und wich im renazifizierten Teil Deutschlands einer entschiedenen Westbindung. Konnte man nun zwar die Dominanz auf dem Kontinent nicht unmittelbar durchsetzen, so erhoffte man sich zumindest eine Sonderrolle für die BRD, die schließlich an vorderster Stelle mit dem Bolschewismus rang. Auch hier war ein enger Zusammenschluss Europas von Interesse, denn man dachte – wie der CSU-Politiker Franz Josef Strauß es formulierte –, nur durch die „Europäisierung der deutschen Frage“ könne die Einheit des Vaterlandes wiederhergestellt werden.
Nicht allein auf der Welt
Nachdem die deutsche Einigung vollzogen war, begann ab Mitte der 1990er Jahre der nächste Anlauf, europäische Hegemonialmacht zu werden. Zwar entwickelten sich die deutschen Europa-Konzeptionen nicht in bruchloser Kontinuität von Bethmann Hollweg über Werner Daitz bis zu Angela Merkel und Wolfgang Schäuble. Bei allen Unterschieden der sich je nach Kräfteverhältnissen wandelnden Strategien gibt es aber Konstanten, die immer wiederkehren – bis heute.
Eines der treibenden Motive war und ist der Gedanke, dass Deutschland allein nicht in der Lage ist, im Wettbewerb mit den anderen „Großraumwirtschaften“ zu bestehen. Europa dient in dieser Perspektive als Vehikel, um sich gegen die Gegner auf dem Weltmarkt, heute neben den USA vor allem die aufstrebenden Volkswirtschaften der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), behaupten zu können.
Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte es in ihrer Rede zum 25. Bundesparteitag der CDU in Hannover am 3. Dezember 2012 auf den Punkt: „Deutschland ist nicht allein auf der Welt. Es gibt über 1,3 Milliarden Chinesen, es gibt 1,2 Milliarden Inder. Sie alle ringen mit uns 80 Millionen Deutschen und mit den 500 Millionen Europäern immer darum, wer Einfluss in der Welt hat und wer in welchem Wohlstand leben kann.“ Die Angst vor der Konkurrenz auf dem ohnehin gebeutelten Weltmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Europa-Liebe des deutschen Kapitals. Hans-Peter Keitel, der Chef der einflussreichsten Lobby-Organisation der hiesigen Industrie, des Bundesverbandes der Industrie (BDI), spricht das ganz ohne Schnörkel aus: „Der Euro verschafft Deutschland das wirtschaftliche Gewicht, um internationale politische Rahmenbedingungen künftig mitzugestalten.“
Ebenfalls Tradition hat die tiefe Überzeugung, dass Deutschland eine Sonderrolle in Europa einnehme, die es dazu prädestiniere, dem Rest der Völkerfamilie zu zeigen, wo‘s langgeht. Deutschland, so der Tenor, habe mit der Agenda 2010 und Hartz IV seine „Hausaufgaben“ gemacht, und sei darum nun in der Pflicht, den Pleitestaaten den Schlendrian auszutreiben. Im Oktober 2012 fragten die Deutschen Mittelstandsnachrichten den Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, ob Deutschland stärker führen solle. Markus Kerber: „Ja, in gewisser Weise ganz sicher.“ Allerdings: „Es gibt in der englischsprachigen Presse auch den Begriff des ‚widerwilligen Hegemons’ (…). Ich gehe noch einen Schritt weiter: Die deutsche Ökonomie ist aufgrund ihrer schieren Größe so etwas wie ein Pol, an dem sich bestimmte Entwicklungen ausrichten.“
Die Entwicklungen, die sich an diesem „Pol“ ausrichten, sind allerdings für die in den sich dergestalt „entwickelnden“ Staaten lebenden Menschen desaströs. Das von Berlin – teils direkt, teils mittels der EU-Troika – den Peripheriestaaten aufgenötigte Kürzungsregime beinhaltet die Abwälzung der Krisenkosten auf die Bevölkerungen, umfassende Privatisierungen und Deregulierungen, den Abbau der Überreste der sozialen Sicherungssysteme sowie die flächendeckende Verbilligung der Ware Arbeitskraft. Der „Fiskalpakt“, an „Hilfen“ geknüpfte Austeritätsdiktate sowie geplante noch weiter gehende Eingriffe in die Souveränitätsrechte der betroffenen Staaten sollen dieses Regime absichern.
Partner und Freunde
Vor dem historischen Hintergrund, dass während beider Weltkriege in Deutschland (Mittel-)Europa-Konzeptionen entwickelt wurden, deren zentraler Punkt die deutsche Dominanz ist, wundert es kaum, dass nicht überall Freude aufkommt über den neuerlichen Versuch Berlins, zwischen Ägäis und Ärmelkanal den Ton anzugeben. Kaum eine Demonstration in Athen, auf der nicht Plakate zu sehen sind, die Angela Merkel im Hitler-Outfit zeigen, kaum eine Tageszeitung in Hellas, die das aufgezwungene Krisenmanagement noch nicht mit jener Zeit der Nazi-Treuhandschaft verglichen hätte.
Um die Sensibilität des Themas weiß man auch hierzulande, weshalb man bemüht ist, zu zeigen, dass man dieses Mal nicht kommt,
| Protest gegen die deutsche Europapolitik am Athener Syntagmaplatz |
um zu rauben, sondern um zu helfen. Wolfgang Ischinger: Die BRD müsse zu einem „gutmütigen Hegemon“ werden, nach dem Vorbild der USA. „Denken Sie an den Marshall-Plan oder die amerikanische militärische Präsenz in Europa, wo aus Besatzungsarmeen Partner und Freunde geworden sind. Die USA waren (…) bereit, über Jahrzehnte ihren Schutzschirm über Europa zu halten, damit es sich entwickeln kann.“ Dieses Konzept, das stark an den in der Weimarer Republik populären Topos von Deutschland als dem „primus inter pares“ in Europa erinnert, ist in der Tat die derzeit gängigste Version der „europäischen Verbrämung unseres Machtwillens“.
Doch die deutsche Fürsorge scheint anderswo nicht als solche empfunden zu werden: Das Harris Institute ermittelte im Dezember 2012, dass 85 Prozent der befragten Italiener der Ansicht sind, der Einfluss Deutschlands in Europa sei „zu stark“. Zuvor, im Februar 2012, hatte eine Studie des in Athen ansässigen Meinungsforschungsinstituts VPRC ergeben, dass 81 Prozent der Griechen glauben, Deutschland versuche „mittels finanzieller Macht“, Europa „zu dominieren“. Mehr als drei Viertel beurteilten die Haltung Berlins gegenüber Griechenland als „eher feindselig“.
Dieser Artikel erschien zuerst in der aktuellen Ausgabe (2, 2013) von Hintergrund – Das Nachrichtenmagazin.
Hier können Sie Hintergrund abonnieren oder auch Einzelhefte bestellen.