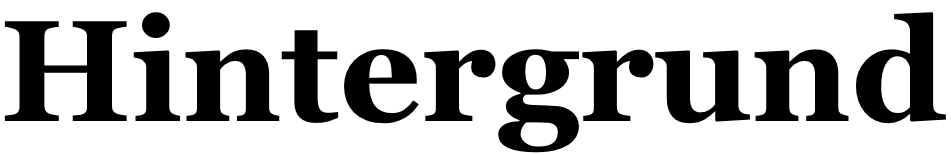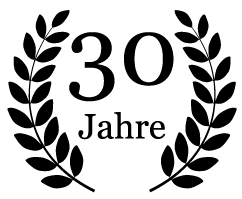Obama
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von IGNACIO RAMONET, 6. Dezember 2008:
Wenn Barack Obama, der neue Präsident der Vereinigten Staaten, am kommenden 20. Januar sein Amt im Washingtoner Kapitol übernimmt, erinnert er sich vielleicht daran, dass dieses Gebäude von schwarzen Sklaven errichtet wurde. Und wenn er einige Stunden später mit seiner Familie das Weiße Haus bezieht, ruft er sich womöglich in Erinnerung, dass auch diese Residenz das Werk von Sklaven ist.
Er selbst stammt nicht von Sklaven ab. Er erfüllt auch nicht das Klischee der "wütenden Schwarzen", vor denen sich Weiße fürchten. Wenn der Kandidat der Demokratischen Partei im Laufe des Wahlkampfes nur ein Mal seine Stimme erhoben hätte, um den Rassismus gegen die farbige Minderheit anzuklagen, so wäre ihm das umgehend als bösartig und gehässig angelastet worden. Er hätte die Wahl verloren.
Seine Taktik war eine andere: Er wies ständig darauf hin, dass die ethnische Zugehörigkeit für ihn keine Rolle spielt. Der Umstand, dass er Schwarzer ist, bedeute nicht, dass er diese Gruppe vertritt. Im Moment seiner Amtsübernahme wird ihn das aber nicht von dem Gedanken abhalten, dass, als er 1961 geboren wurde, in mehreren Bundesstaaten seines Landes noch rassistische Gesetze existierten und zahlreiche Afroamerikaner noch nicht einmal ihr Wahlrecht ausüben konnten. Er wird eine Bilanz des seither Erreichten ziehen. Er wird auf eine Zeit zurückblicken, die von blutigen Kämpfen und außergewöhnlichen Führungspersönlichkeiten wie Malcolm X und Martin Luther King geprägt war – die beide von rassistischen Gruppen ermordet wurden.
Die Wahl von Barack Hussein Obama zum US-Präsidenten beweist zugleich die Flexibilität der US-Gesellschaft. Sie ist ein Beleg dafür, dass der "amerikanische Traum" weiter existiert. Dass "unbegrenzte Möglichkeiten" bestehen. Sie ist eine frische Brise nach acht Jahren faulen Aasgeruchs und abscheulicher Praktiken unter der Bush-Regierung. Deswegen werden das Verbot der Folter und die Schließung des Gefangenenlagers in Guantánamo zu den ersten Entscheidungen des neuen Präsidenten gehören.
Seine einzigartige Biografie, sein elegantes Auftreten, seine fesselnde Redekunst und seine Fähigkeiten eines charismatischen Anführers haben ihn binnen kurzer Zeit zu einem globalen politischen Star gemacht. Zum ersten Mal ist ein US-Präsident (noch ohne zu regieren) in der arabisch-muslimischen Welt, Afrika und Lateinamerika beliebt. In Regionen also, in denen aufgrund der historischen Erfahrung ein allgemein verbreitetes Misstrauen gegenüber „Onkel Sam“ besteht. Und viele kritische Intellektuelle, innerhalb und außerhalb der USA, haben seine Wahl gefeiert.
Nelson Mandela, der erste schwarze Präsident Südafrikas, schrieb in einer Glückwunschnachricht: "Wir sind davon überzeugt, dass Sie endlich Ihren Traum wahr werden lassen können und die Vereinigten Staaten zu einem wirklichen Partner der internationalen Gemeinschaft machen; zu einem Partner, der sich dem Frieden und dem Wohlstand für alle verpflichtet fühlt. Wir sind davon überzeugt, dass Sie auf allen Ebenen gegen die Plagen von Armut und Krankheit kämpfen."[i]
Solche kolossalen und umfassenden Hoffnungen können nur enttäuscht werden. Deswegen hat Fidel Castro, der sich mit nicht weniger als zehn US-Präsidenten auseinander gesetzt hat, für Vorsicht plädiert: "Es wäre ungemein naiv zu glauben, dass die guten Absichten einer intelligenten Person verändern können, was in Jahrhunderten der Interessenpolitik und des Egoismus gewachsen ist. Die menschliche Geschichte beweist das Gegenteil."[ii]
Zumal das Schwerste Obama erst bevorsteht. In erster Linie, weil der Beginn seiner Amtszeit mit der schlimmsten Wirtschaftskrise seit einem Jahrhundert zusammentrifft. Die US-Amerikaner erwarten von ihm und seinem Team die Rettung des Landes vor einer Immobilien-, Banken- und Börsen-Krise, in die es von der Bush-Regierung getrieben wurde. Sie bitten ihn, den industriellen Untergang der drei großen Automobilhersteller anzuwenden: Ford, General Motors und Chrysler. Und damit den millionenfachen Verlust von Arbeitsplätzen.
Er selbst hat den Wiederaufbau eines allgemeinen Systems der Krankenversicherung versprochen, die von den über 40 Millionen US-Bürgern sehnlich erwartet wird, die keinen Krankenversicherungsschutz mehr genießen. Auch die Durchsetzung eines "Grünen New Deal" ist mehr als eine Herkulesaufgabe. Es geht dabei um ein großes Entwicklungsprogramm für neue ökologische Technologien mit dem Ziel, die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Die Schaffung dieser Technologien soll beschleunigt werden, um den Rückgriff auf fossile Energien obsolet zu machen. Ganz so wie 1880, als die Elektrizität Kohle- und Dampfkraft ersetzte.
All das wird nicht von einem Tag auf den anderen umgesetzt werden können. Es wird kostspielig werden und die Vorteile dieses Wandels werden nicht kurzfristig erkennbar sein. Auch scheint das von Obama ernannte wirtschaftpolitische Team kaum geeignet, einen Wandel einzuleiten und das Land aus der Krise zu ziehen. Unter den benannten Experten befinden sich mehrere Ultraliberale, die an der aktuellen Krise eine Mitschuld tragen: Robert Rubin, Laurence Summers oder Timothy Geithner.
Damit wird deutlich, dass die neue Obama-Regierung eine Mitte-Rechts-Ausrichtung haben wird. Auf jeden Fall steht sie weiter rechts als der neue Kongress nach den Wahlen von 4. November. In dieser Situation zeichnen sich – mehr als zunächst erwartet – Konflikte zwischen der Exekutive und der Legislative ab. Denn die neuen Kongressabgeordneten werden die Ungeduld der Wähler direkt weitergeben, die von der Krise am stärksten betroffen sind. Zumal diese Wähler die massiven Hilfsangebote des Staates an Banker mit nach wie vor skandalös hohen Einkommen höchst irritiert zur Kenntnis nehmen müssen. Alles in allem könnte der heute herrschende Enthusiasmus schon morgen in Enttäuschung, Frustration uns Wut umschlagen.
Auch in der US-amerikanischen Außenpolitik wird es für den neuen Präsidenten nicht einfach werden, seine Ideen des Wandels durchzusetzen. Die Ära Bush hat unter Umständen den Höhepunkt der weltweiten Hegemonie der Vereinigten Staaten markiert, einer Macht, die sich am Ende als kurzsichtig und ineffektiv entpuppt hat. Denn die Kriege in Irak und Afghanistan haben unter Beweis gestellt, dass militärische Übermacht nicht automatisch einen politischen Sieg bedeutet. Zugleich erlaubt der Aufstieg Chinas und Indiens die Prognose, dass die Tage der weltweit führenden Wirtschaftsmacht USA gezählt sind.
So könnte Obama allein die Aufgabe zukommen, die "neue Dekadenz" seines Landes zu verwalten.[iii] Eine Aufgabe, die in jedem Fall gefährlich ist. Denn er könnte von der Gnade derjenigen abhängen, die weiter eine Politik der Überreizung und Eskalation verfolgen. Dabei bestünde in Lateinamerika die Chance auf eine schnelle Verbesserung der Dinge, wenn Washington das Handelsembargo gegen Kuba aufheben oder auch nur abschwächen sowie konstruktive Beziehungen mit Venezuela und Bolivien aufnehmen würde. Aber auch das wird nicht einfach sein.
Die Lage im Mittleren Osten wird weiterhin überaus gefährlich bleiben. Sie kann sich sogar noch verschlechtern. Wenn Obama etwa die Intervention in Afghanistan verstärkt, so wird dies notwendigerweise auch mit einer Zunahme der illegalen Angriffe auf pakistanisches Territorium einhergehen. Damit würde ein Staat destabilisiert, der zugleich über eine enorme Bevölkerung sowie ein nukleares Waffenpotential verfügt. Washington könnte in einen Strudel der Gewalt geraten, der den Befürwortern einer harten und dominierenden Imperialpolitik neuen Aufschwung verleihen würde. In Kabul würden die US-Amerikaner dann womöglich einen „präsentablen Diktator“ installieren. Es wäre die Rückkehr des politischen Zynismus und zugleich die Abkehr vom ethischen Projekt, das Obama während seiner Wahlkampagne verteidigt hat.
Auch wenn Obama die US-amerikanischen Truppen aus Irak zurückzieht, wie er es versprochen hat und wie es die Mehrheit der Bevölkerung wünscht, wird Iran einen klaren Sieg davontragen, weil in Bagdad Schiiten und damit enge Verbündete Teherans am Steuer säßen. Würde eine solche Variante von Saudi Arabien akzeptiert werden, dem großen Feind Irans, dem es Expansionismus vorwirft? Wie würde Israel reagieren, wo im kommenden Februar Wahlen stattfinden, die den aggressiven Teil der Rechten um Benjamin Netanjahu und seine "Falken" an die Macht bringen könnten?
Was macht Obama, wenn diese beiden Staaten eine Übereinkunft treffen, um einen Rückzug Washingtons aus der Region zu verhindern?
Über den Autor:
Ignacio Ramonet ist spanischer Journalist und war von 1991 bis März 2008 Direktor der in Paris erscheinenden Monatszeitung für internationale Politik „Le Monde diplomatique“. Seit seinem Ausscheiden bei der französischen Mutterausgabe leitet er die spanische Edition. Seine Leitartikel der spanischen Ausgabe von Le Monde diplomatique erscheinen ab November 2008 monatlich in deutscher Übersetzung bei www.hintergrund.de. Ignacio Ramonet ist Ehrenpräsident von Attac und Mitorganisator des Weltsozialforums.
Übersetzung für Hintergrund: Harald Neuber
[i] Le Monde, Paris, 8. November 2008
[ii] Castro, Fidel: La reunión de Washington. In: Granma, Havanna, 14. November 2008
[iii] Financial Times, London, 18. November 2008
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.