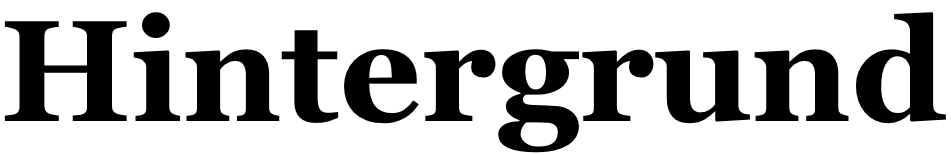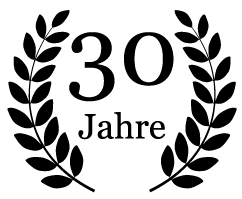Kampf um Afrikas Schätze
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Von GERD SCHUMANN, 6. Juli 2012 –
Vor einem Jahr konstituierte sich der ölreiche Südsudan als Staat – ein bewusster Tabubruch mit Folgen nicht nur für dessen Drahtzieher in den Schaltzentralen des Westens. Alte Kolonialgrenzen stehen plötzlich zur Disposition: von Darfur über Libyen und die gesamte Sahelzone inklusive Mali und Niger bis nach Nigeria. Es ist das wachsende, kaum noch fassbare Elend, das die Menschen nicht mehr nur zur Flucht zwingt oder in die nackte Verzweiflung führt, sondern zunehmend auch Widerstand herausfordert. Nichts ist mehr sicher. Der Westen zieht alle Register, seine Vorherrschaft zu erhalten. Nach dem Libyen-Krieg und der offenen militärischen Einmischung in Côte d`Ivoire 2011 wird auch 2012 der Einsatz von neokolonialer Gewalt als eine Variante erwogen – in Mali und andernorts. Derweil verlängerte der UN-Sicherheitsrat den Einsatz von 7000 Soldaten, 900 Polizisten und einer nicht bekannten Zahl von zivilen Mitarbeitern (UNMISS) im Südsudan zum 7. Juli um ein weiteres Jahr.
Dieser 9. Juli 2011 in Dschuba, der neuen Hauptstadt des neuen Landes, war ein Tag wie aus dem Märchenbuch: Strahlender Himmel, die Nationalhymne unverbraucht, das Tuch der Flagge mit dem gelben Stern im hellblauen Dreieck ebenso, feierlich gestimmte Menschen zu Tausenden, Gäste aus aller Welt. Unter ihnen sogar der Präsident des Sudan Omar al-Baschir, der bisherige Erzfeind. Südsudan konstituierte sich als Republik, und es herrschte, äußerlich betrachtet, eitel Sonnenschein. „Unabhängigkeit“ – bisher ein zauberhaftes Wort überall dort, wo einst die Kolonialmächte des Nordens das Sagen hatten.
Doch in diesem Fall passte so einiges nicht ins gängige Schema: Der sudanesische Süden war nicht von den Reichen der Nordhalbkugel dominiert worden, sondern von den einheimischen Mannen um al-Baschir: Gerade dieser galt bereits seit 1993 – zumindest nach Lesart der USA – als Oberganove eines „Schurkenstaates“ und wurde, ganz in Wildwestmanier, 2009 per Steckbrief vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur Fahndung ausgeschrieben. Und noch etwas war anders: Die neue politische Elite des Landes, die ausnahmslos von der SPLM (Sudan People‘s Liberation Movement) (1) gestellt wurde, unterschied sich grundsätzlich von den Befreiungsbewegungen der Vergangenheit, genoss sie doch ausdrücklich das Wohlwollen der alten und neuen Kolonialisten in London und Washington. Sah so die Befreiung der christlich oder animistisch geprägten, überwiegend schwarzen Bevölkerung aus?
Virus der Sezession
An diesem 9. Juli, einem Samstag, entstand entlang der Ethnien und Religionen – je nachdem, ob die weitgehend von Marokko besetzte arabische Saharaui-Republik DARS in die Rechnung einbezogen wird – der 54. oder 55. Staat Afrikas. Nicht nur Skeptiker warnten damals vor einem – nach Somalia – zweiten afrikanischen „failed state“ (2) sowie vor dem „Virus der Sezession“, der sich weiterverbreiten könnte, so der Völkerrechtler Norman Paech. (3) Tatsächlich steht es ein Jahr nach der historischen Jubelfeier in Dschuba nicht nur schlecht um das Projekt Südsudan. Zudem wirkte der Abspaltungsprozess signalgebend für andere.
Der Grundsatz der Afrikanischen Union (AU), „Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten“ zu verteidigen (4), hat schweren Schaden genommen und wird nun zunehmend infrage gestellt. Bisher war eine Veränderung der Grenzen als „Präjudiz“ gemieden worden, weil diese, „einmal durchbrochen, einen Flächenbrand für ganz Afrika hätte einleiten können“, so der Professor für Internationales Recht, Werner Ruf. (5) Inzwischen schwelt es in verschiedenen Ecken, von Darfur über die Sahelzone bis nach Nigeria und die Demokratische Republik Kongo. Und in Libyen erfolgten nach dem Angriff durch die westliche „Koalition der Willigen“ im Frühjahr und Sommer 2011 öffentliche Planspiele, wie denn das Maghreb-Land aufgeteilt werden könnte. Dabei drehte sich hier wie dort – und egal, wie die Konflikte gedeutet wurden – alles um die Schätze dieser Länder.
Südsudan
Nach heutigem Wissen liegen über 75 Prozent von Sudans Schwarzem Gold in den Böden des Südens. Der Zugriff auf das Öl war den großen Energiekonzernen – vorrangig Chevron aus den USA und der britisch-niederländischen Shell – seit Jahrzehnten verwehrt: Zunächst nach 1983 als Kriegsfolge, dann nach 1993 unter dem Vorzeichen der internationalen Ächtung des Sudan. Seit 1997 verhängen die USA alljährlich bis heute Sanktionen im Zuge ihrer Offensive gegen Khartum als vorgeblichen „Unterstützer des Terrorismus“. (6)
Der Sudan schloss daraufhin langfristige Verträge mit China. Unter anderem erwarb Peking 1997 vierzig Prozent jener Anteile, mit denen vormals Chevron das Recht zur Ausbeutung sudanesischen Öls zugesprochen worden war. Die Republik Sudan entwickelte sich nach und nach zu Chinas wichtigstem ausländischen Ölstandort, eine Position, die zuvor Angola innehatte. Peking baute den Ölterminal und die Raffinerie in Port Sudan, dem Überseehafen am Roten Meer, Straßen, Dämme, Elektrizitätswerke sowie ein Pipelinesystem vom Süden nach Khartum.
Trotz seines Handelsembargos bemühte sich Washington weiter um Einfluss, das Öl des Südens fest im Blick. Die US-Strategie „zielte immer auf die Unabhängigkeit Südsudans, die sie mit zahlreichen Nichtregierungsorganisationen und mit der Ausrüstung der SPLA (Sudanesische Volksbefreiungsarmee, Anm. Red.) unterstützten“ (7) An modernem Gerät fehlte es der „Volksbefreiungsarmee“ bereits vor 2005 nicht, als das „Umfassende Friedensabkommen“ (Comprehensive Peace Agreement, CPA) mit Khartum nach jahrelangen Verhandlungen, deren Moderation Washington oblag, endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde.
Die USA hatten Schritt um Schritt den auf fünf Jahre ausgelegten Etappenplan zur Beendigung des Bürgerkrieges durchgesetzt. Am 9. Januar 2005 unterzeichneten die Konfliktparteien das CPA, in dem das schicksalhafte Referendum über die Unabhängigkeit des Südens festgelegt und mit ihm die Spaltung des Landes festgeschrieben wurde. Seit 2011 regieren Washingtons historische Partner einen eigenen Staat, der den Zugriff auf das begehrte Öl ermöglichen und zugleich den lästigen Konkurrenten aus dem Reich der Mitte zurückschlagen oder ganz verdrängen soll. „Wir können Afrika nicht den Chinesen überlassen“, plauderte der damalige ThyssenKrupp-Chef Ekkehard Schulz schon Ende 2010 aus dem Nähkästchen der Konzernstrategie. (8) Die deutsche Industrie müsse sich in einer Art „Rohstoff-Arbeitsgemeinschaft zusammentun“, so der Kern seines neokolonialistischen Projektes.
Mittlerweile wird wieder – nunmehr innersudanesisch zwischen zwei Staaten – Krieg um das Öl in verschiedenen Grenzregionen geführt, „ein Krieg, den sich keiner leisten kann“. (9) Gekämpft wird gleich an mehreren Fronten. Südsudans Präsident Salva Kiir erklärte, seine Armee hätte die Ölfelder in der Region Heglig besetzt. Das Eingeständnis der Aggression wiederum sorgte für eine schnelle Reaktion selbst des sonst bezüglich eines kritischen Umgangs mit von den USA protegierten Staaten mehr als zurückhaltend agierenden UN-Sicherheitsrates. Der „Tatbestand eines Angriffskrieges“ ließ sich schwerlich vom Tisch wischen, zumal der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag 2009 in einem Urteil festgestellt hatte, dass Heglig zu Sudan gehört. (10)
Die Besatzung des Gebietes wurde zwar nach militärischen Konfrontationen mit Hunderten Toten abgebrochen, doch sorgt vor allem die von Dschuba unterstützte SPLA-North mit ihrer Forderung nach einem Anschluss der Provinz Südkordofan mit Heglig, der Abiyei-Region und den Nuba-Bergen an den Südsudan für Unruhe. „Dieser Krieg kann noch Jahre dauern“, prognostiziert der Vizekommandant der Nuba-Aufständischen, Philip Kawa. „Wir befinden uns derzeit in der Defensive.“ Das liege „nicht zuletzt“ am Desinteresse der „internationalen Gemeinschaft“. Kawa fordert vom Westen, den bewaffneten Widerstand der Nuba zu unterstützen. (11)
Derweil wird der Streit um die Stadt Jau vor den Vereinten Nationen ausgetragen. „Jau gehört zum Südsudan“, erklärte Ende Dezember 2011 der UNO-Botschafter Südsudans, David Buom Choat, vor dem Sicherheitsrat. Sein Kollege aus Khartum, Daffa-Alla Elhag Ali Osman, hielt dagegen, dass sich Jau „zu hundert Prozent im Norden“ befinde. (12) Ende Februar 2012 wurde schließlich bekannt, dass an der Seite der südsudanesischen Armee auch „Kämpfer der Rebellengruppe Justice and Equality Movement (JEM) aus Darfur beteiligt“ waren. Es sei „offen eingestanden“ worden, dass „eine Zusammenarbeit zwischen westsudanesischen und südsudanesischen Rebellen“ existiert. Die sudanesische Regierung geht gar davon aus, dass „der Rebellenangriff von Offizieren der regulären südsudanesischen Streitkräfte befehligt“ wurde. (13)
Darfur
Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der – bereits seit Beginn des Aufstandes im südlichen Sudan 1983 entstandenen – SPLM und Darfur-Aufständischen, darunter auch die 1999 gegründete JEM, war bisher als offenes Geheimnis gehandelt worden. Dementsprechend konnte auch von einer indirekten Unterstützung der USA für Darfur-Rebellen ausgegangen werden. Wie weit Washington und andere ausländische Kräfte in sudanesische Auseinandersetzungen um Darfur beispielsweise durch Waffenlieferungen involviert sind, lässt sich nur vermuten.
Tatsache ist, dass die Westprovinz einerseits an Wassermangel leidet, dass Elend und Massenfluchten die Lage der Bevölkerung kennzeichnen, andererseits aber beachtliche, in weiten Teilen unerschlossene Ölvorkommen existieren. Parallelen zum Südsudan drängen sich auf, die historische Abspaltung vom Sudan inklusive. Die Instrumentalisierung menschlichen Elends bleibt. In den vergangenen Jahren diente das Thema Darfur zur internationalen Isolierung des „Schurkenstaates“. Neben Tibet war es zudem das herausragende Subjekt für das Engagement Hollywoods in Sachen Menschenrechte. George Clooney und Mia Farrow stehen dafür. Zur Klarheit trug es nicht bei.
Oberflächlich betrachtet verläuft die Konfliktlinie – nicht nur im Sudan – zwar zwischen Ethnien oder Religionen. In der Realität handelt es sich aber in den meisten Fällen um Verteilungskämpfe vor dem Hintergrund von Armut und Hunger weiter Teile der Bevölkerung. „Nirgendwo gibt es so viel Elend, so wenig sauberes Wasser und so viele Analphabeten“ wie im Südsudan. (14) Neben dem territorialen Streit und dem desolaten Zustand des jungen Staates am Ende des ersten Jahres seiner Existenz verhindert vor allem die komplizierte Vermarktung des Schwarzen Goldes einen Alleingang Dschubas. Sämtliche Ölexporte stehen und fallen mit der Nutzung der Pipeline-Infrastruktur vom Süden über Khartum nach Port Said. Alternativen dazu waren in den vergangenen zehn Jahren häufiger im Gespräch, doch scheiterten sie allesamt.
Verkehrswege und Leitungssysteme zum Indischen Ozean nach Kenia oder über Uganda zum Kongo-Fluss wurden angedacht und schienen zeitweise Konturen anzunehmen. Zuletzt bot Japan, nach China der zweitgrößte Käufer sudanesischen Öls, 1,5 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Pipeline vom Südsudan durch Uganda und Kenia nach Mombasa an. Allerdings würde die Realisierung eines derartigen Projektes „mindestens zehn Jahre dauern, um den Süden vom Norden unabhängig zu machen“. (15) Also wäre es sinnvoll, zu einer politischen Lösung zu kommen, die sowohl Khartum mit seiner Verfügungsgewalt über die Transportinfrastruktur als auch Dschuba mit dem Zugriff auf den Rohstoff zufriedenstellte – zumal die Spannungen bereits zu einem dramatischen Einbruch der Ölproduktion mit entsprechenden Folgen für die Staatseinnahmen beider Sudans geführt haben.
Im Südsudan selbst kommt es derweil immer wieder zu Scharmützeln rivalisierender Gruppen um Wasser und Bodenschätze „eines auf Klans und Ethnien gestützten bitteren Konkurrenzkampfes um Ressourcen und sozialen Status“, so die Afrika-Korrespondentin der ZEIT, Andrea Böhm.(16) Sie fragt etwas hilflos, wie diese Krieger davon überzeugt werden sollten, „ihre Waffen aufzugeben, wenn es keinen Staat gibt, der Sicherheit herstellen kann“. Sage und schreibe 700.000 Kalaschnikows gebe es im Südsudan – 700.000 AK-47-Maschinenpistolen bei acht Millionen Einwohnern. Im Bundesstaat Jonglei, wo der Konflikt zwischen Nuer und Murle besonders verbissen ausgetragen wird, soll nunmehr eine Entwaffnungskampagne durchgeführt werden, notfalls unter Einsatz von Gewalt. Das hatte die SPLA 2006 schon einmal praktiziert. „Die Aktion endete mit Hunderten von Toten aufseiten der Zivilisten wie der Armee“. (16)
Das Beispiel Südsudan könnte ganz Afrika als mahnendes Beispiel für eine misslungene Staatsgründung dienen und deren Hintermänner enttarnen. – Wird es aber nicht.
Libyen
Den libyschen Staat, der sich seit Jahrzehnten für eine Unabhängigkeit des afrikanischen Kontinentes von neokolonialer Bevormundung engagierte, gibt es nicht mehr. Muammar al-Gaddafi wurde ermordet, die Öl-Karten werden neu gemischt und verteilt. Der Westen triumphiert – und scheint doch mit ungeahnten Problemen konfrontiert. Es wird immer deutlicher, dass die ab März 2011 geführten Luftattacken durch die NATO-Koalition der Willigen unter französisch-britischer Führung mit US-amerikanischer Beteiligung zur Destabilisierung über Libyens Grenzen hinausführten. Besonders stark betroffen ist die Sahelzone mit Tschad, Mauretanien, Mali, Niger. Zudem könnten vom Umbruch infolge des Libyen-Krieges auch Teile Westafrikas ergriffen werden. Selbst wenn mit dem Ende der Gaddafi-Ära – und mit ihr der Weg einer selbstbestimmten Entwicklung – letztlich die territoriale Einheit des nordafrikanischen Landes nicht zerschlagen wurde, so rückt die Forderung nach neuen Grenzziehungen zunehmend auf die afrikanische Agenda.
Die NATO habe „Libyens Bengasi gerettet und dafür Timbuktu in Mali verloren“, sagt zum Beispiel Gregory Mann, Professor in New York und ausgewiesener Sahel-Experte. (17) Und Davis Zounmenou vom südafrikanischen Institut für Sicherheitsfragen meint, die „Sezessionsgelüste“ der zum Volk der Berber gehörenden Tuareg unter den südlichen Anrainern der Sahara beschwörten eine „Gefahr für die ganze Region“ herauf. (18) Von der Zusammenstellung einer „Interventionstruppe“ der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS in Mali ist die Rede, führende NATO-Staaten haben eine „Task Force Sahelzone“ wegen des Tuareg-Aufstandes gebildet.
Dieser wird maßgeblich von den aus Libyen vertriebenen Offizieren und Soldaten der Gaddafi-Truppen – die Zahlenangaben schwanken zwischen dreihundert und mehreren Tausend – getragen, die sich der laizistischen „Nationalen Bewegung für die Befreiung Azawads“ (Mouvement national pour la libération de l‘Azawad, MNLA) angeschlossen haben. Sie nutzen „ihren militärischen Sachverstand nunmehr für die Verwirklichung eines alten Traumes der Tuareg: ein eigenes Land namens Azawad“, so FAZ-Korrespondent Thomas Scheen.(19) Unterstützt wurden sie dabei zeitweilig von der islamisch orientierten Gruppe „Ansar al-Din“ (Verteidiger des Glaubens); diese wiederum soll über Kontakte zu al-Qaeda im Maghreb (AQMI) verfügen. Bis heute blieben die Konstellationen im Norden Malis unübersichtlich. In der historischen Wüstenstadt Timbuktu kam es Ende Juni zu Zerstörungen von Mausoleen für Sufi-Heilige, derweil in westlichen Medien die „islamistische Gefahr“ beschworen wird. Von einer „Afghanisierung der gesamten Sahel-Region“ ist die Rede.(20) Es heißt, dass mittlerweile die Vorherrschaft der Tuareg gebrochen sei. Die ECOWAS hat einen Sondergipfel einberaumt, die Nationalversammlung in Bamako möchte indes „die territoriale Integrität“ mit militärischer Gewalt wiederherstellen, also mit einer geschlagenen Putschisten-Armee. Der UN-Sicherheitsheitsrat beriet am 6. Juli wieder einmal zur Lage –, verurteilte „Feindseligkeiten“ und drohte nunmehr offen mit einem Truppenaufmarsch. Wie immer interessierten Konfliktursachen nicht. Stattdessen wird nun auch in Sachen Mali schnellstens eine internationale Drohkulisse aufgebaut.
Mali
Planmäßig sollte in Mali im April gewählt werden. Bis heute blieb ein Rätsel, wie die Abstimmung unter den Bedingungen anhaltender Repression durch Bamako sowie des Krieges im Norden einigermaßen „frei und fair“ hätte abgehalten werden können. Folglich kam der Aufstand der „unteren Ränge“ der Armee im Februar unter Führung von Hauptmann Amadou Sanogo nicht unbedingt überraschend. Mahamadou Diarra von der linken Parlamentspartei SADI benannte unter anderem „Inkompetenz, Korruption, eine drohende Nahrungsmittelkrise und Unregelmäßigkeiten im Vorfeld der Nationalwahlen und des Verfassungsreferendums“ als Putschgründe. Das „Fass zum Überlaufen gebracht“ habe dann „die wachsende Unzufriedenheit innerhalb der Armee“. (21)
Die Rebellen wollten „dem Aderlass ihrer Kameraden ein Ende setzen“ (22), so das vorgebliche Motiv von Hauptmann Sanogo, der insbesondere den USA und Frankreich mit seiner Aktion einen Strich durch die Rechnung machte, ihre Vorherrschaft im Land selbst, aber auch in Westafrika insgesamt mit dem Mantel der Legalität zu verdecken: Ausgerechnet der in den USA ausgebildete Sanogo bereitete seinen ehemaligen Gastgebern Schwierigkeiten. Seine Vorgesetzten, meinte er, unterschätzten die Probleme im nördlichen Landesdrittel – dort, wo große Teile des malischen 70000-Mann-Heeres von der MNLA zusehends in die Defensive gedrängt wurden. Es folgte der Putsch und damit eine Form von „Krieg gegen den Terror“, für den Sanogo einst gedrillt worden war, die seine Ausbilder wohl nicht gemeint hatten. Vor allem hatten sie nicht damit gerechnet, dass ihr Terrorkrieg gegen Libyen für eine Umwälzung des Kräfteverhältnisses in der Sahelzone mit Langzeitwirkung sorgen könnte.
Paris hätte es wissen müssen. Nicht erst seit der Unabhängigkeit der Sahel-Staaten von Frankreich 1960 wird dieses „traurige Stück Afrika“, in dem es nur wenige Schulen gibt, kaum Krankenstationen, selten Brunnen, gelinde gesagt, vernachlässigt. (23) Allerdings scheint im Gegensatz zum Südsudan eine Anerkennung des am 6. April von der MNLA ausgerufenen Staates Azawad (Land der Nomaden) für AU und Europäische Union tabu. Doch wie anders soll dann die Krise bewältigt werden?
Die angedachte militärische Intervention wäre ein Abenteuer mit offenem Ausgang. Sowohl die ECOWAS als auch Frankreich, das bis dato häufig in brenzligen Situationen Elitesoldaten schickte, fürchten ein Scheitern. Zudem sitzt mit François Hollande ein neuer Mann im Élysée-Palast, der seine Afrika-Politik – so die weitverbreitete Hoffnung – nicht wie sein Vorgänger Nicolas Sarkozy auf das Militär der „Grande Nation“ stützen wird, obwohl Skepsis durchaus angebracht ist. So wird Laurent Fabius, der neue Außenminister, mit den Worten zitiert: „Die Mächte wechseln, die Interessen bleiben.“ (24)
Die Tuareg-Nomaden, das wissen alle Beteiligten, kennen die Wüste und das gesamte Gebiet wie ihre Westentasche. Unklar ist, ob sie angesichts des Vorrückens islamischer Gruppierungen, über deren Stärke nur spekuliert werden kann, weiterhin militärisch agieren werden. Jedenfalls verfügen Teile von ihnen, besonders aber die Tuareg über den „Heimvorteil“. (25) Auch gehört der Militärstützpunkt mit Landebahn nahe dem strategisch wichtigen Ort Tessalit im Nordosten, siebzig Kilometer von der algerischen Grenze, nun den Rebellen. Er war bisher als Kontrollpunkt der USA und Frankreichs für die Region ins Auge gefasst worden.Die malische Armee befindet sich nach der schweren Niederlage, die ihr die MNLA innerhalb weniger Tage zufügte, sowie dem Militärputsch gegen Präsident Amadou Toumani Touré am 21. März in desolatem Zustand. Eine blitzartige Hilfsaktion der US-Armee, die Spezialausbilder aus Colorado fünf Wochen lang eine malische Elitetruppe trainieren ließ, änderte daran ebenso wenig wie Geld und Material aus Washington.
Am 1. Mai schließlich wurde in Bamako ein Mann als Premier einer Übergangsregierung installiert, der – neben dem malischen – auch einen Pass der Vereinigten Staaten von Amerika besitzt. Cheick Modibo Diarra, Astrophysiker, lange Zeit in führenden Positionen der US-Raumfahrtbehörde NASA tätig, seit 2006 Afrika-Chef von Microsoft, übernahm mit dem Posten des Ministerpräsidenten „ein politisches Himmelfahrtskommando“. (26) Seine Zukunft steht in den Sternen. Und vor allem, ob er einen vernünftigen Weg der Verständigung mit den Tuareg gehen will und darf.
Diesen zu beschreiten, fällt auch deswegen schwer, weil die Interessen von Nachbarstaaten Malis direkt tangiert werden. Die Vieh züchtenden Tuareg leben grenzübergreifend in weiteren Ländern der Region, darunter in Mauretanien, Burkina Faso, Algerien, Nigeria und vor allem in Niger. Die etwa 600000 Tuareg dort stellen die absolute Bevölkerungsmehrheit gerade in jenem Gebiet südlich der algerischen Grenze, in dem einer der global begehrtesten Stoffe lagert. Er macht das ansonsten nicht mit Reichtümern gesegnete Gebiet zum Objekt der Begierde ausländischer Mächte: Niger gehört zu den fünf größten Uranproduzenten weltweit.
Zwangsläufig drängt sich die Frage nach dem „Wie weiter?“ auf, falls Azawad als Tuareg-Staat im ehemaligen Mali tatsächlich zum – je nach Lesart – 55. oder 56. Land Afrikas würde. Obwohl MLNA-Chef Mohamed Ag Najem erklärte, dass der neue Staat ausschließlich im Nordosten Malis angesiedelt sei, geht die Angst vor Abspaltungen auch anderswo um. In Niger fürchten Frankreich, dessen weitgehend staatliche Areva-Gruppe sowie die Regierenden in der Hauptstadt Niamey um die Einheit des Landes. Ihre Interessen verlangen den Erhalt der Ausbeutungsstrukturen. Der Atom- und Energiekonzern und seine Töchter förderten seit 1968 mehr als 100.000 Tonnen Uran.
Die Folgen für Umwelt und Arbeiter sind katastrophal, Klagen wegen Erkrankungen und der Zerstörung und radioaktiven Kontaminierung ganzer Landschaften um die Minenstädte herum wurden weitgehend ignoriert. Insbesondere die Provinzhauptstadt Arlit geriet wiederholt in die Schlagzeilen der Weltpresse, weil der Abbau des radioaktiven Erzes durch Areva nachweislich verheerende Schäden bei Mensch und Tier und in der Natur verursachte. Proteste halfen nicht. Allerdings wurden sie auch nicht zum Schweigen gebracht.
Berliner Konferenz
Die Reichen der Welt, die einst Afrika unter sich aufteilten, sehen sich zunehmend gezwungen, neue Wege zur Sicherung der Herrschaftsstrukturen zu suchen. Die auf der Berliner Konferenz 1884/1885 von den Kolonialmächten – in vielen Fällen mit dem Lineal fernab ethnischer, religiöser oder historischer Gegebenheiten – gezogenen Grenzen sind nicht mehr heilig. Die zeitgenössische Karikatur, die den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck als Gastgeber zeigt, der am Kaffeetisch eine Torte mit der Aufschrift „Afrique“ Stück für Stück zwecks Verteilung unter den 14 Konferenzteilnehmern aufschneidet, erfährt eine neue, aktualisierte Bedeutung. Die Tortenstücke müssen hier und dort noch einmal beschnitten werden, um die Kontrolle zu sichern.
Die Gesamtlage hat sich verändert. Afrikaweit verschlechtern sich die Lebensbedingungen der Bevölkerung seit mindestens zwei Jahrzehnten, dem Ende der globalen Bipolarität und damit des Ringens der Blöcke um Einflussnahme. Nach anfänglichen Erfolgen der ab den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts formal unabhängigen Staaten wurden zwar weitere umfangreiche natürliche Ressourcen entdeckt und zur Ausbeutung erschlossen, doch in nahezu allen Fällen kamen die Reichtümer den alten Kräftezentren in Europa und Nordamerika zugute. Diese sorgten ihrerseits dafür, dass die nationalen Eliten einen ihnen gewogenen Kurs hielten.
Auf dem internationalen Kräftefeld hat sich zudem China mit einer Politik, die für Bodenschätze mit Arbeitsplätzen und sozialer Infrastruktur zahlt, als wichtigster Gegner der USA und der EU in Afrika etabliert und Ansätze zu einer Emanzipation des Kontinentes eröffnet – aber auch noch nicht mehr als Ansätze. Die Abhängigkeit Afrikas von seinen Naturschätzen blieb, und damit die Abhängigkeit von deren Abnehmern.
Stabile Ausbeutungsstrukturen zu sichern, wird angesichts der wachsenden Gegensätze zunehmend schwieriger. Fluchtbewegungen großen Ausmaßes nach Norden zeugen überdeutlich davon. Europa schirmt sich ab, versucht einerseits, Afrika abzuschotten, andererseits auf dem Kontinent selbst die jeweiligen nationalen Repressionsinstrumente zu nutzen und zu erweitern. Dass auch im 21. Jahrhundert immer noch Abermillionen Menschen vom Hunger bedroht sind – wie jüngst und jetzt wieder in Ostafrika und der Sahelzone –, ist „eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Lebensmittel stehen jederzeit an jedem Ort der Welt zur Verfügung, wenn auch zu einem hohen Preis“. (27) Den zu zahlen, liegt den Profiteuren in der EU und deren afrikanischen Vertretern ebenso fern wie der Einsatz geeigneter Regulierungsmethoden, die eine Zerstörung der einheimischen Produktion verhindern, etwa durch die Errichtung von Zollschranken für Nahrungsmittelimporte EU-subventionierter Dumpingpreisprodukte.
Die verfahrene, dem System einseitiger Abhängigkeit geschuldete Misere erzeugt Unmut, Widerstand und Formen sozialen Protestes. Dieser entwickelt sich häufig auf ethnischer und religiöser Ebene. Drastische Beispiele aus jüngster Zeit betreffen fast ausnahmslos alle meist mit Waffen ausgetragenen Krisen von Ruanda über den Ostkongo, von Somalia nach Côte d‘Ivoire, von Kenia zum Sudan bis nach Libyen. Dabei bilden die Unterschiede bezüglich Ethnie und Glauben lediglich die Erscheinungsebene. Ob es den Agierenden bewusst ist oder nicht, sie bedienen jeweils auch die Interessen nationaler Eliten oder ausländischer Mächte.
Nigeria
Zum Beispiel Nigeria. Mit dem Öl des westafrikanischen Staates decken die USA etwa ein Zehntel ihres gigantischen Energiebedarfes. Wie dort das Zusammenspiel zwischen Multis und Regierungen funktioniert, enthüllten die Ende 2010 von WikiLeaks veröffentlichten US-Botschaftsdepeschen. Demnach teilte die Botschaft Washingtons in Abuja dem State Department mit, dass der Multi Shell die nigerianische Regierung „infiltriert“ habe. „In allen relevanten Ministerien“, so Konzernvertreterin Ann Pickard, sei Shell vertreten und wisse „alles“, was dort geschehe – unter anderem, dass Rivalen wie die russische Gazprom oder chinesische Firmen versuchten, sich im Land zu platzieren. Um das zu verhindern, habe sie über die Botschaft beim State Department um Unterstützung angefragt. (28)
Über vierzig Prozent der gesamten nigerianischen Ölproduktion werden in die USA geschafft. Das Land selbst ist dazu gezwungen, Benzin zu importieren – und zwar, mangels eigener Raffinerien, seinen gesamten Bedarf. „Ich fasse es nicht: Als achtgrößter Erdölerzeuger der Welt und größter Afrikas leidet Nigeria unter empfindlichem und chronischem Treibstoffmangel“, formulierte der weltweit wohl renommierteste Entwicklungspolitiker, Jean Ziegler, 2008 in Der Hass auf den Westen, seinem Buch zu den Auswirkungen des Neokolonialismus in den betroffenen Ländern des Südens. (29)
Das gewaltige Niger-Delta mit einer Fläche von mehr als 70000 Quadratkilometern gehört zu den ökologischen Krisengebieten der Erde und gilt als weitgehend verseucht. Einerseits sorgen Öl-Leckagen für Verschmutzungen ungeheuren Ausmaßes – verursacht durch Fehlbedienungen der hoch komplizierten Förderanlagen oder durch Materialfehler. Die Luft wird wegen der Verschmutzung durch ausströmendes oder verbranntes Gas auf Dauer zu einer tödlichen Gefahr für die Bewohner. „Tag und Nacht flammen die Fackeln, gigantische Feuersäulen, die in den Himmel schießen. Vollkommen straffrei.“ (30)
Ölleitungen werden immer wieder undicht, mit katastrophalen Folgen für das Grundwasser. Küstenfischerei wird zu einer fernen Erinnerung. „So haben die Beutejäger der transkontinentalen Ölkonzerne mit ihrer hemmungslosen Profitgier die Existenz von Millionen nigerianischen Fischern, Landwirten, Viehzüchtern und Gemüsebauern zerstört.“ Der mächtigste unter den Ausbeutern ist die Royal Dutch Shell Group, die ein Pipelinesystem von über 6000 Kilometern betreibt und offshore wie an Land Tausende Ölquellen besitzt. (31)
Neunzig Prozent der Deviseneinnahmen des Landes werden im Niger-Delta produziert. Die etwa 27 Millionen Bewohner dort müssen mit weniger als einem US-Dollar täglich auskommen und bohren in ihrer Not schon mal die eine oder andere Pipeline an oder fordern Lösegeld für entführte Mitarbeiter von Ölkonzernen. Zu grundsätzlichen Veränderungen der Strukturen von privater Aneignung und gesellschaftlicher Unterdrückung führte der Widerstand bisher indes nicht.
Die in der Hafenmetropole Lagos sowie in der Hauptstadt Abuja angesiedelte Elite, die „Militärpaten“, wie Ziegler sie nennt, kassierten zwischen 1997 und 2007 jährlich zehn bis zwölf Milliarden US-Dollar. Afrikaspezialist Jean-Christophe Servant errechnete, dass von den „350 Milliarden Petrodollar, die seit der Unabhängigkeit eingenommen wurden, 50 Milliarden“ im Korruptionsbereich verschwanden. (32) Zugleich fristen neunzig Prozent der – geschätzt – über zehn Millionen Einwohner des Molochs Lagos ihr Leben in ausgedehnten Slums.
Das bevölkerungsreichste Land Afrikas ist seit Langem de facto gespalten, und „die internationale Presse fragt“, so Le Monde diplomatique, ob der Riesenstaat „nicht auf eine Teilung zwischen dem muslimischen Norden und dem christlichen Süden zusteuere“. (33) Tatsächlich stoßen im westafrikanischen Land am Atlantik die Gegensätze zwischen ungeheurer Verelendung und ebenso unglaublichem Reichtum besonders krass aufeinander. Insofern mag Nigeria als prototypisch für die dramatische Entwicklung in verschiedenen Teilen Afrikas angesehen werden und ergo ebenso für die sich daraus ergebenden Überlegungen des Westens, wie er zukünftig Macht und Einfluss erhalten kann.
Auch in Nigeria verläuft die Grenze zwischen Arm und Reich nicht grundsätzlich zwischen den Religionen und Ethnien, selbst wenn Vetternwirtschaft und Stammeszugehörigkeiten eine Rolle bei der Verteilung spielen. Mehr als sechzig Prozent der Bevölkerung verfügen über weniger als zwei US-Dollar täglich, ob im Süden oder im Norden. Doch unterscheidet sich der Widerstand der überwiegend muslimisch und zum Teil auch radikal-islamisch beeinflussten Armen im Norden von den bewaffneten Aktionen der Rebellengruppen an und vor der Atlantikküste nicht nur in seinen Formen – Massenaktionen verbunden mit Anschlägen zum einen, Entführungen und Lösegeldforderungen zum anderen –, sondern auch in seiner Wirkung. Im Niger-Delta sieht sich die Zentralgewalt zu massiver Kontrolle und harter Repression gezwungen, um ihren Zugriff auf das Öl zu sichern. Über die zukünftige Verfasstheit des Nordens dagegen darf, so scheint es, durchaus nachgedacht werden.
Die über Jahrzehnte bewusst in Kauf genommene, von der westlichen Dominanz geradezu veranlasste Massenverelendung ließe sich nur durch eine Umverteilung der Öleinnahmen dauerhaft bekämpfen. Dazu müssten den Energiekonzernen Shell, Chevron, Agip, Total und deren mit dem nigerianischen Staat verwobenen Subunternehmen vertragliche Fesseln – beispielsweise eine radikale Beschneidung der Profitrate – angelegt werden. Zudem wäre unumgänglich, die willfährige, korrumpierte Oberschicht in Abuja und Lagos zur Ader zu lassen. Doch fehlt dafür ein politisches Konzept.
Seit über dreißig Jahren gelingt es Armee und Polizei, immer wieder aufflackernden Widerstand mit brutalen Mitteln niederzuschlagen.1980 starben 4000 Menschen in der nördlichen Großstadt Kano, als staatliche Spezialkräfte die antiwestliche Maitatsine-Bewegung auflösten. International nahezu unbeachtet blieben die Ereignisse in der zentralnigerianischen Provinzmetropole Jos, einer Schlüsselstadt zwischen Nord und Süd. Im Umfeld von 9/11 starben dort zwischen dem 6. und 13. September 2001 etwa tausend Einwohner bei „Unruhen“. Jos als „zerrissene Stadt“ zwischen Muslimen und Christen sei „erstmals in seiner Geschichte“ zu einem Ort von „Massenmord und Zerstörung“ geworden. (34)
Von der Regierung unter ausländischem Druck in Auftrag gegebene Untersuchungsberichte dazu liegen bis heute nicht vor. In Kano, Jos und andernorts halten die gewalttätigen Proteste an. Jüngst kamen bei einem Bombenanschlag auf eine katholische Universität 17 Menschen ums Leben. Mitte Juni wurden drei christliche Einrichtungen gesprengt, im Anschluss kam es zu Racheaktionen Jugendlicher mit insgesamt hundert Opfern. Sechs Tote wurden infolge eines Angriffes auf „einen Polizeichef im Nordosten“ gemeldet. US-Außenministerin Hillary Clinton zeigte sich prompt „besorgt über die Angriffe auf Kirchen, Medien und Regierungsbehörden“. Die „Terroristen“, so Clinton, wollten „christlich-muslimische Spannungen entzünden“. Präsident Goodluck Jonathan hielt es für notwendig, die „Einheit des Landes“ zu beschwören und sie durch „Verurteilung und Ablehnung der Terroristen“ zu verteidigen. (35)
Eine mögliche Abspaltung des Nordens wird zumindest verbal für möglich gehalten. Argumentiert wird mit Feindbildern, ausgeklammert bleiben die Ursachen für wachsende Gewalt in Afrikas ölreichstem Staat, der auf der weltweiten Armutsskala ganz weit unten geführt wird. Unterstellt wird, dass die Gründe für die Misere des Kontinentes hausgemacht sind. Behauptet wird, das Argument, Afrikas Zustand sei eine Folge des Postkolonialismus, also des Versuches der ehemaligen Kolonialmächte, über korrumpierte Eliten den Zugriff auf die Bodenschätze des Kontinentes zu sichern, treffe nach Ende des Kalten Krieges nicht mehr zu. Vielmehr habe insgesamt betrachtet ein Demokratisierungsprozess begonnen und zeitige – trotz mancher Rückschläge – doch Erfolge, wie jüngst im Senegal.
Senegal
Tatsächlich steht der Senegal als einheitlicher Staat, zu Kaisers Zeiten fest in reichsdeutscher Hand, derzeit nicht zur Disposition. Die Präsidentenwahl in dem westafrikanischen Staat, der nach dem Ersten Weltkrieg Frankreich zufiel und 1960 in eine neokolonial geprägte Unabhängigkeit entlassen wurde, verlief im März 2012 trotz aller Unkenrufe sowie handfester Gewalt schließlich „abgesehen von kleineren Unregelmäßigkeiten fair“, wertete die Europäische Union den Verlauf der Abstimmungen. Diese seien eine „Lehrstunde in Demokratie“ für die Region (36), ein „friedlicher Wechsel mit Stil“. (37) Und Frankreichs damaliger Staatspräsident Sarkozy gratulierte dem Sieger der Stichwahl, Macky Sall. Dessen Erfolg sei „eine sehr gute Nachricht für Afrika im Allgemeinen und für Senegal im Besonderen“.
Selbstverständlich bezog der französische Vormann der Republik Senegal auch den unterlegenen Amtsinhaber Abdoulaye Wade, der Paris ein Dutzend Jahre hindurch treu gedient und sich dabei robuster Methoden im Kampf gegen die sozialistische Opposition bedient hatte, in sein Lob ein und „beglückwünschte“ den Autokraten dafür, dass „die Wahl so „würdig“ über die Bühne gegangen sei. (38) Eine würdige Lehrstunde in Sachen westlicher Demokratie also, den Weltmusiker Youssou N‘Dour als Kandidaten mit der lächerlichen Begründung, er habe nicht genügend Unterstützerstimmen gesammelt, von der Wahl auszuschließen.
Eine „Würdigung“ des sonderbaren Umgangs Wades mit der Verfassung? Des Einsatzes seines Geheimdienstes, der eine bekannte Ärztin in Dakar umgehend „besuchte“, nachdem sie „die Befähigung des Greises, eine weitere Amtszeit von sieben Jahren durchzustehen“, bezweifelt hatte. (39) Oder des Polizeieinsatzes mit Tränengas gegen Demonstranten am Wahltag, nachdem zuvor mehrere Menschen bei Protesten getötet worden waren?
Mit Macky Sall hatte der „politische Ziehsohn“ den 85-Jährigen, der die Arroganz der Macht „geradezu zelebrierte“, beerbt, der in den Augen des Westens als moderatere, jedenfalls moderne Version der politischen Herrschaftssicherung gilt – ein „Wade light“ sozusagen. Er, und die so „demokratische“ Art und Weise, wie er Wades Erbe übernahm, könnten eine „Lektion für Mali“ darstellen, meinte denn auch Thijs Berman Chef der EU-Beobachtermission mit Blick auf Senegals östlichen Nachbarn. (40)
Die Geister
In Mali und anderswo machen sich derweil nicht die Gespenster einer „Demokratie“ genannten Ordnung breit, sondern die Geister der Spaltung, einmal gerufen, selbständig. Ob sie die Macht nur etwas anders verteilen und das Elend der Bevölkerung anhält, bleibt abzuwarten. Weiter verschlechtern kann sich der Zustand des Kontinentes kaum, wie ein Blick auf die inoffizielle UN-Rangliste aller Staaten der Erde bezüglich ihres Entwicklungsstandes in Sachen Lebenserwartung und Bildungschancen offenbart. Im unteren Drittel der 187 auf dem Human Development Index (HDI) von 2011 geführten Länder befinden sich 39 afrikanische, darunter Nigeria und Mauretanien. 19 Staaten sind unter den letzten 20 zu finden, darunter Sudan, Niger, Mali und die Demokratische Republik Kongo als Schlusslicht. Bestplatzierte Afrikaner: Libyen als 64. vor Mauritius (77.) und Algerien (96.).
Nur drei Staaten vom zweitgrößten Kontinent der Erde, der „Wiege der Menschheit“, sind unter den ersten hundert. Die Konquistadoren der Moderne leisten im Sinne Bismarcks ganze Arbeit.
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.
Anmerkungen und Quellen:
1 Die Sudanesische Volksbefreiungsbewegung SPLM wurde ebenso wie ihr bewaffneter Arm, die SPLA (Sudan People`s Liberation Army) 1983 gegründet. Zur Partei geworden regiert sie heute die Republik Südsudan. Aus der SPLA und anderen bewaffneten Gruppen soll eine neue Armee gebildet werden.
2 „Scheitert der Sudan als Staat?“: Thorsten Brenner in „Der Tagesspiegel“, 8.7.2011
3 „Sudan: Öl, Krieg und Spaltung“, Prof. Norman Paech in Ossietzky, 1/2011
4 http://www.netzwerkafrika.de/dcms/sites/nad/afrika/afrikastrukturen/au.html
5 „Gelockerte Fesseln, Werner Ruf, Professor für Internationale Politik, in junge Welt, 24.8.2010
6 Website des US-state department. http://www.state.gov/j/ct/c14151.htm).
7 „Sudan: Öl, Krieg und Spaltung“, Prof. Norman Paech in Ossietzky, 1/2011
8 Deutsche Welle, 30.11.2010.
9 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 23.4.2012
10 http://de.euronews.com/2009/07/22/schiedsgerichtshof-entscheidet-ueber-grenzstreit-im-sudan/
11 Berliner Zeitung, 15.2.2012
12 AFP, 8.12.2011
13 FAZ, 28.2.2012
14 Der Spiegel, 50/2010
15 „Sudan: Öl, Krieg und Spaltung“, Prof. Norman Paech in Ossietzky, 1/2011
16 Die Zeit, 8.3.2012
17 Der Spiegel, 192012
18 Frankfurter Rundschau, 30.3.2012
19 FAZ, 2.4.2012
20 Der Spiegel, 19/2012
21 junge Welt, 26.2.2012
22 Frankfurter Rundschau, 30.3.2012
23 FAZ, 2.4.2012
24 http://www.bladi.net/forum/316729-victoire-francois-hollande-coup-dur-monarchie/index5.html. Prof. Nicolas Agbohou, Berlin, 24.6.2012
25 Der Spiegel,19/2012)
26 FAZ, 1.5.2012
27 FAZ, 21.2.2912
28 http://www.sueddeutsche.de/politik/wikileaks-shell-in-nigeria-sie-wissen-alles-1.1034143
29 Jean Ziegler, „Der Hass auf den Westen“, München 2009
30 dito
31 dito
32 Le monde diplomatique, April 2006332 Le monde diplomatique, April 2012
34 http://www.unhcr.org/refworld/docid/3c272b4e7.html
35 http://www.n-tv.de/politik/Sechs-Menschen-sterben-article6155551.html)
36 FAZ, 26.3.2012
37 Frankfurter Rundschau, 27.3.2012
38 Focus online, 26.2.2012
39 FAZ, 23.3.2012
40 dpa, 27.3.2012