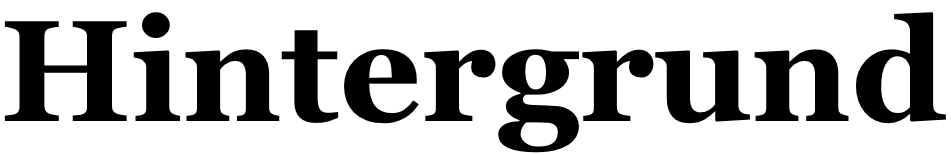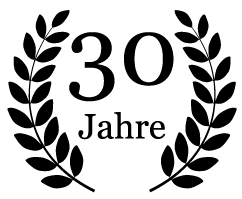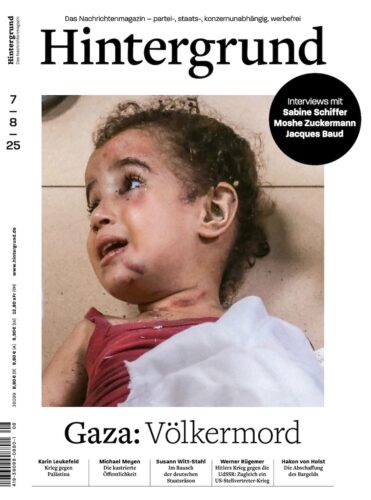Verheugen: „Wir müssen uns von den USA emanzipieren“
Günter Verheugen gehört in Bezug auf den Krieg in und um die Ukraine zu den wenigen namhaften Kritikern bundesdeutscher und europäischer Politik. Sein Urteil hat Gewicht. Er war als EU-Kommissar (1999 bis 2010) unter anderem für die Osterweiterung der Union zuständig. Kürzlich hat er in Berlin den von Sandra Kostner und Stefan Luft herausgegebenen Sammelband „Ukrainekrieg – Warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht“ vorgestellt. Im Anschluss sprach Tilo Gräser mit ihm über das Thema.
 Günter Verheugen: „Es gibt kein eigenes Nachdenken in der EU, wie wir zu einem tragfähigen Friedensschluss in der Ukraine kommen.“ (Berlin, 6. Juni 2023)
Günter Verheugen: „Es gibt kein eigenes Nachdenken in der EU, wie wir zu einem tragfähigen Friedensschluss in der Ukraine kommen.“ (Berlin, 6. Juni 2023)Hintergrund: Herr Verheugen, wie schätzen Sie das, was derzeit in der Ukraine passiert, ein?
Günter Verheugen: Dieser Krieg ist die größte Gefahr für den Weltfrieden seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Augenblick ist nicht zu erkennen, wie die Eskalation gestoppt werden kann. Ebenso ist nicht zu erkennen, wann und wie der Weg zu einer Verhandlungslösung beschritten wird. Und man muss einfach wissen: Es handelt sich um einen Krieg, an dem eine nukleare Supermacht direkt und eine andere indirekt beteiligt ist. Das zeigt das Gefahrenpotenzial, das in diesem Konflikt für uns alle steckt. Deshalb geht er auch uns alle an! Es ist nach meiner Meinung nicht so, dass in der Ukraine unsere demokratische Verfasstheit oder unsere Freiheit verteidigt wird. Das ist genauso falsch, wie gesagt wurde: Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Es geht uns deshalb alle an, weil die Konsequenzen uns alle treffen, wenn dieser Krieg in einen nuklearen Schlagabtausch entartet.
Hintergrund: Sie haben kürzlich bei einer Buchvorstellung über die Vorgeschichte gesprochen. Bis wohin reicht die Vorgeschichte?
Verheugen: Die Vorgeschichte reicht nach meiner Meinung zurück bis in die Tage vor der Herstellung der deutschen Einheit. Ich denke, dass das gebrochene Versprechen, die NATO nicht nach Osten auszuweiten, ein erster Baustein war, um das Vertrauen zwischen Russland und dem Westen insgesamt ins Wanken zu bringen. Ich glaube, dass in dieser Zeit die Chancen versäumt wurden, die es auf dauerhaften Frieden gegeben hätte. Denken Sie an Gorbatschows Idee vom gemeinsamen europäischen Haus. US-Präsident Clinton hat die Möglichkeit erwogen, Russland die Mitgliedschaft in der NATO anzubieten. Es ist auch darüber diskutiert worden, die NATO umzubauen zu einer Art wirkungsvolleren OSZE. Alle diese Ansätze und Möglichkeiten sind im Lauf der Jahrzehnte versandet bzw. hintertrieben worden.
Hintergrund: Und worin sehen Sie die Ursachen dieses Krieges, der am 24. Februar 2022 offen ausgebrochen ist?
Verheugen: Es gibt viele Ursachen, und ich bin weit davon entfernt, Putin für schuldlos zu erklären und die Aggressionshandlung zu entschuldigen oder zu verteidigen. Das ist und bleibt unentschuldbar. Wohl aber ist die Frage erlaubt, welche legitimen völkerrechtlichen Möglichkeiten Russland in den letzten Jahren hatte, seine Sicherheitsinteressen vorzutragen, zu vertreten und möglicherweise auch durchzusetzen. Im Kern geht es um das russische Sicherheitsbedürfnis, das nicht verstehen will und wahrscheinlich auch nicht verstehen kann, warum der Westen, das heißt in diesem Fall die NATO unter Führung der USA, ganz eindeutig eine Politik der Einkreisung gegenüber Russland verfolgt. Es liegt ja auf der Hand, dass, wenn ich eingekreist werde, ich das als eine Bedrohung empfinde. Das ist eine Ursache.
Eine andere Ursache ist zweifellos, dass mit der Zusage an die Ukraine, dass sie der NATO beitreten könne, für Russland sicherheitspolitisch eine rote Linie überschritten wurde, wissentlich und willentlich. Und letztlich muss man die Ereignisse in der Ukraine selbst betrachten. Da spielt die Vorgeschichte des Maidan, der Regime Change 2014 und die dann folgende antirussische Politik der von den US-Amerikanern gewünschten Regierung eine Rolle.
<!--
Hintergrund: Ein Anlass des Konfliktes in der Ukraine 2013/2014 war die Frage des EU-Assoziierungsvertrages. Sie waren lange Zeit für EU-Osterweiterung zuständig. Wie sehen Sie die europäische Rolle in dem Konflikt?
Verheugen: Das EU-Assoziierungsabkommen zur Ursache des Konflikts zu machen, ist Unsinn. Es war auch kein Anlass. Das Abkommen war bereits im Jahr 2011 zu Ende verhandelt. Es war fertig verhandelt und paraphiert worden mit der angeblich russlandhörigen Regierung unter Präsident Janukowitsch. Janukowitsch wollte sogar, dass die EU-Mitgliedschaftsoption im Abkommen festgehalten wird. Das Abkommen hätte eigentlich 2012 unterzeichnet werden sollen. Damals gab es nicht den geringsten russischen Protest. Aber 2012 band die EU die Unterzeichnung an Bedingungen. Unter anderem forderte sie, dass die frühere Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die wegen Korruption im Gefängnis saß, freigelassen wird. Das war vor allen Dingen eine Berliner Initiative, die von ein paar verantwortungslosen Gesellen im Umkreis der Kanzlerin ausgeheckt wurde. Das konnte die Ukraine nicht liefern.
Im Jahr 2013 hatten sich die Verhältnisse dramatisch verändert, die Ukraine war in schweres wirtschaftliches und finanzielles Fahrwasser geraten. Gleichzeitig negierte die EU russische Beschwerden, die den wirtschaftlichen Teil der Assoziierung betrafen, weil de facto zwischen Russland und der Ukraine auch Freihandel herrschte. Das alles stieß in der EU auf taube Ohren. Deshalb setzte Janukowitsch die Unterschrift aus. Er wollte die EU-Assoziierung, aber brauchte Geld und fürchtete die Auflagen des IWF wegen der massiven innenpolitischen sozialen Auswirkungen.
Die Aussetzung der Unterschrift in Vilnius 2013 wurde fälschlich als Verweigerung der Janukowitsch-Regierung interpretiert, sich der EU annähern zu wollen, und das setzte den Maidan in Gang. Er verwandelte sich aus spontanem Prozess in eine westliche Allianz mit der ukrainischen Opposition. Das war Teil einer langfristig vorbereiteten US-Regime-Change-Operation. Das ist keine Spekulation. Das ist unter anderem durch öffentliche Aussagen von Frau Nuland belegt, aber auch durch ein geleaktes Telefonat.
Hintergrund: Nun erleben wir, dass im Zuge dieses Krieges die ehemalige sogenannte Ostpolitik, die Entspannungspolitik, diffamiert wird und auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden soll. Sie waren selbst an dieser Politik beteiligt. Wie bewerten Sie das, was da heute geschieht?
Verheugen: Ich betrachte das als geradezu ehrverletzend. Es ist eine bewusste Fehlinterpretation der Entspannungspolitik der sozialliberalen Koalition, wenn sie auf die völlig falsche und niemals von der Politik verwendete Formel „Wandel durch Handel“ reduziert wird. Es ging nicht um Geschäftemacherei. Die Formel hieß „Wandel durch Annäherung“. Annäherung nicht der Überzeugungen und Wertvorstellungen, sondern Annäherung im buchstäblichen Sinne. Dass man sich näherkommt, miteinander redet, dass man die jeweils bestehenden Sorgen, Ängste, Befürchtungen und berechtigten Interessen auslotet. Dass man die Gemeinsamkeiten herausfindet. Dieses Ausloten war ein Prozess, der sich über viele Jahre hingezogen hat und dann in die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) im Jahr 1975 in Helsinki mündete. Diese Schlussakte hat in idealer Weise die außenpolitischen Interessen und die außenpolitischen Werte des Westens vertreten. Die übereinstimmenden Interessen bestanden darin, sich vor einem möglichen Überfall oder Angriff zu schützen. Der wertbezogene Teil bestand darin, dass mit dem sogenannten Korb III der KSZE-Schlussakte, dem Menschenrechtskorb, für die Menschen in den osteuropäischen Ländern und in der Sowjetunion eine Berufungsgrundlage geschaffen worden ist. Diese Grundlage ist ja auch genutzt worden. Die Bürgerrechtsbewegung in der DDR stützte sich darauf, ebenso die tschechoslowakische „Charta 77“ und so weiter. Diese Entspannungspolitik hat tatsächlich Wandel bewirkt. Es kam, wie die sozialliberale Koalition bei der Debatte im Bundestag 1975 vorhergesagt hat, nicht zu einem Wandel in dem Sinne, dass wir uns an das Sowjetsystem angepasst hätten, sondern der Wandel erfasste den ehemaligen Ostblock. Die Sowjetunion veränderte sich, wurde aufgelöst, überall gab es friedliche Revolutionen, bei uns den Mauerfall. Deutschland wurde wiedervereinigt. Wenn das kein Wandel ist …
Hintergrund: Was sagen Sie als ehemaliger SPD-Außenpolitiker zu Büchern und Äußerungen ihrer ehemaligen Parteifreunde wie Oskar Lafontaine und Klaus von Dohnanyi, dass die deutsche Politik und die europäische Politik im Verhältnis zu den USA wieder mehr die eigenen Interessen betonen und verwirklichen muss?
Verheugen: Das ist richtig. Vor allem Klaus von Dohnanyi stimme ich fast in jedem Satz zu, den er geschrieben hat. Und ich bin froh, dass Klaus von Dohnanyi, ein alter Freund und Weggefährte, bei der Analyse der Lage zu denselben Ergebnissen gekommen ist wie ich. Natürlich, wir brauchen die EU als einen eigenständigen globalen Akteur. Das heißt, wir müssen uns von den US-Amerikanern emanzipieren. Das heißt aber auch, dass wir bereit sein müssen, die Verantwortung für unseren Heimatkontinent in die eigenen Hände zu nehmen. Wir waren gedanklich zumindest da schon einmal weiter als im Augenblick. Es besteht wenig Hoffnung, dass wir auf diesem Weg vorankommen. Ich bin zutiefst pessimistisch, was die Zukunft Europas angeht. Ich glaube, wir sind im Augenblick Zeuge der Beerdigung einer jahrhundertealten großen Idee, dass es möglich ist, Europa zu einer politischen Einheit zu machen. Das stirbt gerade.
Hintergrund: Welche Chancen gibt es, die Entspannungspolitik wiederzubeleben, wie Sie fordern? Welche Chancen dafür sehen Sie angesichts der aktuellen Situation?
Verheugen: Nun, im Augenblick erscheint das utopisch. Die politische Großwetterlage ist ganz anders. Die Staatenlenker in Europa und des Westens zeigen kein erkennbares Interesse mehr an der Idee, dass es gesamteuropäische Strukturen geben muss. Ich spreche nicht davon, dass wir die Europäische Union von Lissabon bis Wladiwostok ausweiten müssen. Aber gesamteuropäische, kooperative Strukturen auf den wichtigen Feldern wie Sicherheit, Wirtschaft, Umwelt, Klima, Energie, Technologie waren möglich. Diese Chance ist in der Vergangenheit nicht genutzt worden. Ich weiß nicht, ob wir dahin zurückkehren können. Ich habe eben gesagt, wir erleben möglicherweise zurzeit die Beerdigung einer großen Idee. Das heißt der Idee, dass das ganze politische Europa durch ein dichtes Netz von Kooperation geeint ist. Wenn wir auf die Landkarte gucken, dann ist die Europäische Union sogar der kleinere Teil des Kontinents.
Hintergrund: … zu dem auch Russland gehört.
Verheugen: Das ist ja genau der springende Punkt. Diejenigen, die Russland keinen Platz in Europa mehr einräumen wollen, beherrschen die praktische Politik. Mit Schmerz habe ich erleben müssen, dass mein früherer Kollege Joschka Fischer zu dieser Denkrichtung gehört. Wer sagt, Russland gehört nicht zu Europa, der kennt Russland nicht und kennt Europa nicht. Aber wie wir zurückkehren können zu der Idee, dass wir Kooperation statt Konfrontation, Dialog statt Ausgrenzung, vernünftigen Interessenausgleich und wieder gegenseitigen Respekt erzeugen müssen, das weiß ich nicht. Aber das ändert nichts daran, dass man das verlangen muss.
Hintergrund: Ist die europäische Einheit nicht das, was den USA Angst macht?
Verheugen: Ja, wenn es als eine politische Handlungseinheit verstanden wird. Aber so weit bin ich ja gar nicht gegangen. Ich habe nur von Handlungsfähigkeit auch auf globaler Ebene gesprochen. Eine politisch handlungsfähige EU wäre aus Sicht der USA ein Rivale, den es nicht geben soll. Was sie unter allen Umständen zu verhindern suchen, wäre die Verwirklichung des gesamteuropäischen Gedankens unter Einbeziehung Russlands, denn dann wäre der europäische Kontinent ein Schwergewicht, das keines Hegemonen bedarf.
Denn in den USA regieren ja eigentlich längst veraltete geopolitische Denkmuster nach dem Motto: Wer die eurasische Landmasse beherrscht, der beherrscht die Welt. Das ist nicht mehr kompatibel mit den gegenwärtigen Realitäten. Aber die Tragik will es, dass die aktuelle EU sich gegen den Fluss der Zeit nunmehr fest an das permanente Streben der USA nach globaler Dominanz gebunden hat.
Das schwächt die EU auch in ihren Beziehungen mit China und anderen wichtigen Partnern des globalen Südens. Es schwächt sie wirtschaftlich und unterhöhlt auch unsere Vorstellungen von einem European way of life. Das sollte jeder klar sehen. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass sich die EU irgendwann wieder auf das besinnt, was sie am besten kann: auf die Einigung der europäischen Völker, nicht ihre Spaltung. Aktuell sind wir allerdings davon sehr weit entfernt und ein sichtbarer Ausdruck dessen ist, dass es kein eigenes Nachdenken in der EU gibt, wie wir zu einem tragfähigen Friedensschluss in der Ukraine kommen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Günter Verheugen begann seine politische Laufbahn im Jahr 1969. Nach seinem Austritt bei der FDP 1982 ging er zur SPD. Von 1983 bis 1999 war er Mitglied des Deutschen Bundestages, wo er sich hauptsächlich mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen sowie der Europapolitik befasste. Er hatte verschiedene politische Ämter inne und wurde 1999 Mitglied der Europäischen Kommission, bis zum Jahr 2004 war er zuständig für die EU-Erweiterung. Ab 2002 war er außerdem für die europäische Nachbarschaftspolitik verantwortlich. Von 2004 bis 2010 war er Kommissionsvizepräsident und zuständiger Kommissar für Unternehmen und Industrie. Der heute 79-Jährige ist Honorarprofessor an der Europauniversität Viadrina in Frankfurt/Oder und hat eine Reihe von Büchern und Aufsätzen zur Europapolitik, aber auch zu anderen politischen Themen veröffentlicht. Zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Petra Erler betreibt er die Beratungsfirma „European Experience“.
-->Lesen Sie das gesamte Interview und vieles mehr im Hintergrund-Magazin Ausgabe 9/10 2023, das ab 25. August im Handel erhältlich ist oder HIER als Einzelheft oder Abonnement bestellt werden kann.
Der Hintergrund-Newsletter
Wir informieren künftig einmal in der Woche über neue Beiträge.
Wir senden keinen Spam! Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung.
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.