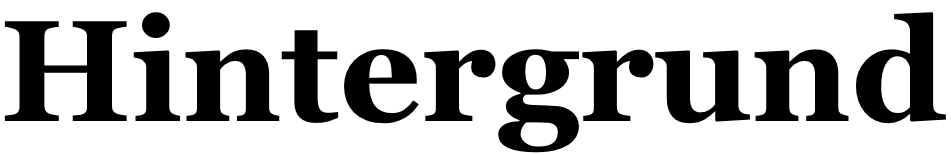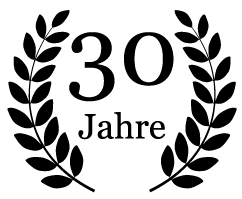Kongo vor Personalwechsel
Mit Vorwürfen von Menschenrechtsverbrechen betreibt der Westen die Absetzung von Präsident Joseph Kabila. Er ist bei der Ausbeutung der Rohstoffe des Landes nicht mehr hilfreich.
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Die Schreckensmeldungen aus der Demokratischen Republik Kongo kommen in einer solchen Regelmäßigkeit, dass sie im Rest der Welt kaum noch wahrgenommen werden. Am vergangenen Samstag wurden einem Bericht der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge zwölf Rebellen und ein Soldat bei Kämpfen in der Provinz Nord-Kivu im Osten des Landes getötet. Nach Angaben von Militärsprecher Jules Tshikudi hatten die Aufständischen Stellungen der Armee angegriffen, seien aber zurückgeschlagen worden. Die umkämpfte Gegend nahe der Grenze zu Uganda, so erklärte Tshikudi, wäre nun wieder unter der Kontrolle der Regierungskräfte. Für das unmittelbare Gefechtsgebiet mag das gelten, ansonsten aber schafft es Kinshasa seit über zwei Jahrzehnten nicht, den Krieg in der Region zu beenden. Regelmäßig greifen Rebellen an, inzwischen wieder häufiger. Erst eine Woche zuvor, am 11. Juni, waren beim Sturm auf ein Gefängnis in der Stadt Beni, nahe derer sich nun die Gefechte ereigneten, elf Menschen getötet und 900 Häftlinge befreit worden. Wer die Angreifer waren, ist bisher nicht einmal ermittelt.
Nord-Kivu ist jedoch nicht der einzige Brandherd im zweitgrößten Flächenstaat Afrikas. Auch in der Provinz Kasaï-Central im Süden des Landes steht die Armee einer Miliz gegenüber. Die Gruppe namens Kamwina Nsapu hatte sich im Juli vergangenen Jahres erhoben, nachdem ihr gleichnamiges Oberhaupt zum Sturz der Regierung und zur Ermordung von Auswärtigen aufgerufen hatte. Im August umstellte die Armee dann die Residenz des Milizenführers und setzte diesem ein Ultimatum. Nachdem es verstrichen war, stürmten Soldaten tags darauf das Anwesen und töteten den Milizen-Chef. Dessen Kämpfer, Medienberichten zufolge größtenteils schlecht bewaffnete Minderjährige, griffen in der Folge Armeeposten an. Dutzende der Aufständischen wurden getötet. Der Konflikt weitete sich in den vergangenen Monaten aus. Inzwischen sind nach Angaben der Vereinten Nationen 1,3 Millionen Menschen aus der Region geflohen, etwa 30.000 von ihnen ins nahegelegene Angola. Am Dienstag berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Bericht der Katholischen Kirche im Kongo, dass dem Konflikt bisher „mindestens 3.383 Menschen“ zum Opfer gefallen seien. Regierungstruppen hätten demnach zehn Dörfer vernichtet, die Kamwina-Nsapu-Miliz weitere vier Dörfer.
Die Vorwürfe kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. Der UN-Menschenrechtsrat berät in Genf gerade darüber, eine eigenständige Untersuchungskommission in die Demokratische Republik Kongo zu entsenden. Der Rat würde damit einer Forderung der USA nachkommen, die damit vorgeblich aufklären wollen, wer für die Entführung und Ermordung zweier UN-Mitarbeiter im März verantwortlich war. UN-Menschenrechtskommissar Zeid Al-Hussein warf der kongolesischen Regierung am Dienstag zudem vor, eine mit ihr im Kampf gegen die Kamwina Nsapu verbündete Miliz zu unterstützen, die „schreckenerregende Attacken“ verübt habe. Er sprach von Berichten über zu Tode gehackte schwangere Frauen und Säuglinge und forderte ebenfalls die Einrichtung einer internationalen Untersuchungsgruppe. Die Regierung in Kinshasa weigert sich jedoch gegen eine Untersuchung ohne Beteiligung kongolesischer Behörden. Derlei Ermittlungen „wären inakzeptabel“, erklärte Justizminister Thambwe Mwamba am Montag in Genf. „Das wäre, als wären wir kein unabhängiges Land“, erklärte Mwamba und verwies darauf, dass vier der Mörder der UN-Mitarbeiter bereits festgenommen worden seien. Dass sein Einwand Gehör findet, ist jedoch unwahrscheinlich.
Denn die Vermutung, dass im Kongo ein Regime-Change vorbereitet wird, liegt auf der Hand. Zu viele Feinde hat sich Präsident Joseph Kabila inzwischen gemacht. Dessen Zeit an der Staatsspitze war eigentlich im vergangenen Dezember abgelaufen. Da die Wahlkommission sich nicht im Stande sah, eine landesweite Abstimmung durchzuführen, blieb er jedoch im Amt. Nach gewalttätigen Protesten schloss die Regierung schließlich am Silvesterabend unter Vermittlung der katholischen Kirche einen Deal, demzufolge Kabila nach Neuwahlen in diesem Jahr zurücktreten sollte. Doch ein Urnengang ist noch immer nicht in Sicht, die katholische Kirche hat sich inzwischen gar wieder aus dem Vermittlungsprozess zurückgezogen. Die Zeichen stehen auf Konfrontation.
Innerhalb der Demokratischen Republik Kongo hat Kabila politisch derzeit zwar wenig zu befürchten. Der wichtigste Oppositionsführer Étienne Tshisekedi ist im Februar im Alter von 84 Jahren verstorben, seine Partei Union für Demokratie und sozialen Fortschritt (Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS) im Kampf um die Nachfolge gespalten. Kabila hat die Opposition auch immer wieder dadurch geschwächt, dass er deren führende Köpfe mit Regierungsposten auf seine Seite zog. In westlichen Medien gilt auch deshalb nun ein Mann als aussichtsreichster Kandidat, der im Kongo wegen des angeblichen Aufbaus einer Söldnertruppe noch strafrechtlich verfolgt wird und der deshalb derzeit im Exil in Europa weilt: Moïse Katumbi. Der langjährige politische Weggefährte Kabilas war bis 2015 Gouverneur der rohstoffreichen Provinz Katanga und wurde dort als Bergbaumagnat reich. 2015 verkaufte er seine Firma, die Kupfer- und Kobaltförderrechte besaß, an ein französisches Konsortium. Am vergangenen Freitag verkündete Katumbi nun in Paris, „bald“ in den Kongo zurückkehren zu wollen, um bei den Präsidentschaftswahlen anzutreten.
Der für den Westen passende Nachfolger scheint also gefunden, der Druck auf Kabila steigt nun. Bereits Anfang Juni verhängten die USA und die Europäische Union neue Sanktionen gegen kongolesische Regierungsvertreter. Kabila selbst ist davon bisher zwar nicht direkt betroffen, hat aber offensichtlich keine Hoffnung mehr auf eine Einigung mit den alten Geschäftspartnern. Nachdem er sich durch Beteiligungen an dutzenden Unternehmen selbst bereicherte und westlichen Bergbaukonzernen jahrzehntelange Steuerbefreiungen gewährte, versucht der Staatschef sich nun als antiimperialistischer Vorkämpfer afrikanischer Souveränität darzustellen. In einem Anfang Juni veröffentlichten Spiegel-Interview auf die Sanktionen angesprochen, entgegnete Kabila: „Ich bin komplett gegen Neokolonialismus und diese Aktionen setzen diesen nur fort.“ Sein Land werde derzeit „zum Box-Sack“ gemacht. „Kongo hier, Kongo da, Kongo und die Menschenrechte“, schimpfte Kabila, „aber wir handeln nicht auf Grundlage dessen, was der Westen denkt“.
Mit seinem Konfrontationskurs versucht Kabila offensichtlich, die Afrikanische Union (AU) hinter sich zu bringen. Sie propagiert zumindest in der offiziellen Darstellung „afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme“, konnte sich aber in der Praxis – Stichwort Libyen-Krieg – gegen die Vormachtstellung des Westens bisher nicht durchsetzen. Und selbst wenn die AU Kabila bisher nicht unter Druck gesetzt hat, so regt sich doch auch auf dem Kontinent Widerstand gegen das Vorgehen des kongolesischen Präsidenten. In der vergangenen Woche veröffentlichte der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan zusammen mit neun afrikanischen Ex-Staatschefs einen „dringenden Appell für einen friedlichen demokratischen Übergang in der Demokratischen Republik Kongo“. Die Gruppe warnt in dem Schreiben vor „kontinentalen Auswirkungen“ einer ungelösten Krise in dem Land und sieht die Zukunft des Kongo „in ernster Gefahr“. Kabila werfen Annan und die einstigen Staatenlenker vor, das im Dezember geschlossene Abkommen zur Machtübergabe nicht zu respektieren und damit „einen gewaltfreien politischen Übergang“ zu „gefährden“.
Auch aus Angola, einem langjährigen Verbündeten von Kabilas Regierung, kam zuletzt aufgrund der Flüchtlingskrise deutliche Kritik. Der Schwiegersohn des dortigen Langzeitstaatschefs José Eduardo dos Santos, Sindika Dokolo, seinerseits ein schwer reicher Geschäftsmann, Kongolese und Ehegatte der mit unzähligen Konzernbeteiligungen sowie Geschäften mit Staatsunternehmen zur reichsten Frau des Kontinents aufgestiegenen Präsidententochter Isabel dos Santos, verglich Kabila gar mit dem ehemaligen kongolesischen Diktator Mobutu Sese Seko. Die Botschaft ist klar: Die Eliten brauchen Kabila nicht mehr, denn er hat sich infolge der zunehmenden gewaltsamen Konflikte als wenig hilfreich bei der effektiven Ausbeutung des Landes erwiesen. Dass er nun auch noch eine neue Flüchtlingswelle zu verursachen droht, macht ihn vor allem für die EU noch weniger tragbar. Deswegen, und nicht aufgrund der jahrzehntelang ignorierten Menschenrechtsverletzungen oder einer eigenmächtigen Amtszeitverlängerung, will der Westen Kabila nun stürzen. Der antiimperialistische Bluff des angezählten Staatschefs ist dabei nur Teil des Pokers um die Konditionen seines Ausscheidens.