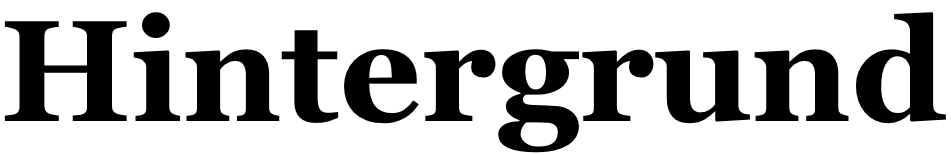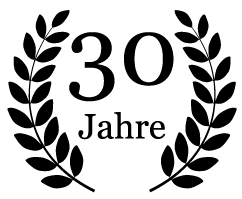Vor dem Kollaps
Personalmangel in Krankenhäusern gefährdet Patienten und Beschäftigte. Dagegen regt sich Widerstand
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
„Keine Pausen – optimale und pflegerelevante bzw. angemessene Betreuung der Patienten ist nicht mehr möglich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gereizt, Fehler unterlaufen; überarbeitet, demotiviert, innerlich gekündigt.“ So und so ähnlich steht es in einer Vielzahl sogenannter Gefährdungsanzeigen, mit denen Beschäftigte in Krankenhäusern auf unhaltbare Zustände aufmerksam machen. Die Gewerkschaft ver.di hat einige dieser Anzeigen in anonymisierter Form veröffentlicht. Sie machen allesamt deutlich: Die Personalnot hat ein Quantum erreicht, das sowohl die Gesundheit der Beschäftigten als auch das Leben der Patientinnen und Patienten gefährdet.
Fast nirgendwo müssen Pflegekräfte so viele Patientinnen und Patienten gleichzeitig betreuen wie in deutschen Krankenhäusern. Laut einer Studie des Projektes Nurse Forecasting: Human Resources Planning in Nursing ist eine Pflegefachkraft hierzulande für durchschnittlich 13 Patientinnen und Patienten zuständig. In den Niederlanden beträgt das Verhältnis 1 zu 7, in den USA 1 zu 5,3. Die Untersuchung belegt zudem, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Pflegequalität und Personalbesetzung gibt – ein Allgemeinplatz, den manche Klinikbetreiber absurderweise bis vor Kurzem noch geleugnet haben.
Laut ver.di fehlen in deutschen Krankenhäusern 162 000 Beschäftigte, davon rund 70 000 in der Pflege. Besonders dramatisch ist die Situation in der Nacht. Um das zu untersuchen, haben 780 Gewerkschafter vom 5. auf den 6. März 2015 bundesweit fast 3 800 Stationen und Bereiche in 238 Krankenhäusern besucht. Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse dokumentieren, dass die schlechte Personalbesetzung Menschenleben gefährdet – und das nicht nur in Einzelfällen, sondern systematisch. So berichten 60 Prozent der Pflegekräfte, dass sie in den vergangenen vier Wochen nachts gefährliche Situationen erlebt haben, die bei einer besseren Personalausstattung vermeidbar gewesen wären. Ist eine Pflegekraft allein für über 40 Patientinnen und Patienten zuständig, steigt dieser Anteil auf 78,3 Prozent (siehe Grafik 1).
Insgesamt arbeiten fast zwei Drittel der Pflegefachkräfte nachts allein auf ihrer Station und betreuen dabei im Durchschnitt 26 Patientinnen und Patienten. Das hat auch zur Folge, dass Leistungen rationiert werden. Drei von vier Pflegekräften berichten, dass sie im letzten Nachtdienst notwendige Leistungen nicht erbringen konnten. Das ist auf großen Stationen noch häufiger der Fall als auf kleineren.
Die gleichen Zusammenhänge zeigen sich bei der Einhaltung der Hygienevorschriften. Laut Robert-Koch-Institut müssen Beschäftigte unter anderem vor und nach jedem Patientenkontakt ihre Hände dreißig Sekunden lang desinfizieren. Ver.di hat ausgerechnet, dass jede Pflegekraft in einem Nachtdienst, in dem sie in der Regel weniger Patientenkontakte hat als tagsüber, insgesamt 39 bis 52 Minuten für die Händedesinfektion aufwenden müsste. Doch in der Realität fehlt dafür oft die Zeit – besonders wenn eine Fachkraft allein eine große Station betreuen muss. So geben 40 Prozent der allein arbeitenden Pflegefachkräfte in Bereichen mit über vierzig Patientinnen und Patienten an, die Händedesinfektion zu vernachlässigen.
Besonders für alte und immungeschwächte Menschen kann das tödliche Folgen haben. Nach Schätzungen der Bundesregierung treten jährlich zwischen 400 000 und 600 000 behandlungsassoziierte Infektionen auf, die rund 15 000 Todesfälle verursachen. Ein Drittel der Infektionen wird als vermeidbar eingestuft – wenn alle Hygieneregeln eingehalten würden.
Fachliche Vorgaben werden auch auf den Intensivstationen verletzt. So empfiehlt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) für Intensivstationen einen Personalschlüssel von einer Pflegekraft auf maximal zwei Patientinnen/Patienten, bei Patientinnen und Patienten mit „speziellen oder besonders schweren Erkrankungen“ ein Verhältnis von 1 zu 1. Tatsächlich aber wird dieser Standard der ver.di-Befragung zufolge in fast 90 Prozent der Intensivstationen missachtet. Auch hier stehen potenziell Menschenleben auf dem Spiel.
Für die Gesundheit der Beschäftigten hat die Überlastung ebenfalls messbare Folgen. So gehen 77 Prozent der Kranken- und 73 Prozent der Altenpfleger/-innen davon aus, nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter in ihrem Job verbleiben zu können. Krankenkassen berichten davon, dass Pflegekräfte weitaus häufiger von psychischen Störungen betroffen sind als andere Beschäftigtengruppen. Auch Rehaleistungen und Erwerbsminderungsrenten müssen einer Studie des Instituts für Arbeit und Technik (IAT) zufolge von Pflegekräften deutlich stärker beziehungsweise früher in Anspruch genommen werden.
Budgetdeckelung und Outsourcing
Die Ursachen für den Personalmangel sind in der in den vergangenen 25 Jahren betriebenen Politik der Ökonomisierung und Privatisierung des Gesundheitswesens zu finden – und zwar weitgehend unabhängig davon, welche Koalition gerade die Bundesregierung stellte. Als das System staatlicher Regulierung der Krankenhausversorgung im Jahr 1972 geschaffen wurde, galten Kliniken noch als Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, für deren Finanzierung der Staat verantwortlich ist. Ausdruck dessen war das Selbstkostendeckungsprinzip: Die Zuschüsse von Krankenkassen und Ländern sollten sämtliche Kosten eines sparsam wirtschaftenden Krankenhauses decken. Reichten die Zuschüsse nicht, konnten die Häuser nachverhandeln.
Mit Durchsetzung der neoliberalen Doktrin galt spätestens Anfang der 1990er Jahre das Dogma, die sogenannten Lohnnebenkosten müssten gesenkt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhöhen. Mit dieser Begründung wurde die Selbstkostendeckung aufgehoben – im ersten Schritt 1993 mit einer Deckelung der Krankenhausbudgets, die von nun an nicht stärker steigen durften als die beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassen. Die Kliniken reagierten mit Kostensenkungen, die zunächst vor allem die Servicebereiche betrafen: Küchen, Wäschereien und Reinigungsdienste wurden ausgegliedert oder an private Dienstleister abgegeben. In der Regel ging das mit einem Verlust der Tarifbindung und drastischen Lohnkürzungen für Neueingestellte einher. Viele Kliniken gründeten selbst Tochterunternehmen für Dienstleistungen, in denen in der Regel ebenfalls keine Tarifverträge galten.
Inzwischen sind die Servicebereiche in den meisten Krankenhäusern ausgegliedert. Nur wenige Arbeiter haben noch einen Vertrag mit der Muttergesellschaft. Insgesamt hat sich die Zahl der Beschäftigten im Wirtschafts- und Versorgungsdienst der Krankenhäuser – die Belegschaften der klinikeigenen Servicegesellschaften mitgezählt – seit der Jahrtausendwende fast halbiert (siehe Grafik 3).
Doch das Outsourcing macht nicht bei sogenannten Dienstleistern halt. Auch patientennahe Bereiche wie Physiotherapie, Patiententransport und Stationsservice werden zunehmend in Tochterfirmen ausgegliedert oder an externe Unternehmen vergeben. Den Preis dafür zahlen nicht nur die Beschäftigten mit dem Verlust ihrer Tarifverträge und zum Teil ihres Jobs. Auch die Gesellschaft als Ganzes kommt für das politisch induzierte Lohndumping auf: Etliche Beschäftigte in den tariflosen Servicegesellschaften müssen ihre mickrigen Gehälter per Hartz IV aufstocken. Was der Staat durch die Kürzung der Krankenhausbudgets auf der einen Seite spart, zahlt er an anderer Stelle also wieder drauf. Ein gutes Geschäft ist das hingegen für private Konzerne, die auf der Grundlage von Niedrigstlöhnen als Klinikdienstleister satte Gewinne einfahren.
Für die Krankenversorgung ist die Zergliederung der Krankenhäuser ein gravierendes Problem. Formal dürfen fest angestellte Pflegekräfte externen Reinigungskräften auf der Station keine Anweisungen geben, Beschäftigte im Patiententransport dürfen sich nicht um die Menschen in dem Bett kümmern, das sie durch die Gänge schieben, prekären und schlecht bezahlten Putzkräften fehlt es oft an der nötigen Qualifikation für Reinigungsarbeiten im Krankenhaus – all das verringert die Versorgungsqualität und hat potenziell gefährliche Folgen, zum Beispiel im Bereich der Hygiene.
Ver.di hat den Ausgliederungen lange wenig entgegengesetzt. In den vergangenen Jahren hat die Gewerkschaft aber in einer Reihe von Servicegesellschaften Tarifverträge erkämpft, die, ausgehend von einem oft sehr niedrigen Niveau, deutliche Lohnerhöhungen beinhalteten. Das ist umso bemerkenswerter, als es für die fragmentierten Belegschaften dieser Unternehmen – ein Großteil der Beschäftigten hat in der Regel nur einen befristeten Arbeitsvertrag oder eine Teilzeitanstellung – ein großer Schritt ist, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Meist treffen Tarifforderungen bei den Arbeitgebern auf erbitterten Widerstand, da sie das Geschäftsmodell der Billiganbieter infrage stellen. Das gilt aktuell beispielsweise für die Servicegesellschaften der landeseigenen Uniklinik in Düsseldorf, die sich beharrlich weigern, überhaupt Tarifverhandlungen aufzunehmen – trotz mehrerer Warnstreiks und des sozialen Geredes der mittlerweile abgewählten rot-grünen Landesregierung.
Marktwirtschaftliche Konkurrenz
Den Gesundheitspolitikern aller etablierten Parteien ging es allerdings nicht allein um Ausgabenkürzungen. Im Jahr 2000 leitete die SPD-Grüne-Regierung einen Systemwechsel ein, der ein anderes Ziel verfolgte: die Einführung marktwirtschaftlicher Mechanismen in das Krankenhaussystem und, damit verbunden, die Möglichkeit privater Konzerne, in diesem Bereich Profite zu erzielen. Dafür wurde ab 2003 das Finanzierungssystem der Krankenhäuser komplett auf sogenannte DRGs (Diagnosis Related Groups) umgestellt. Den Kliniken wurden von nun an für die Behandlung bestimmter Krankheitsbilder Fallpauschalen bezahlt, unabhängig vom tatsächlichen Behandlungsaufwand. Professor Michael Simon von der Hochschule Hannover schreibt dazu: „Erklärtes Ziel der Einführung des DRG-Systems war nicht – wie vielfach angenommen – eine Absenkung der Gesamtausgaben für die Krankenhausbehandlung, sondern eine Umverteilung. Es sollte ‚Gewinner‘ und ‚Verlierer‘ geben, verbunden mit der Vorstellung, dass die Verlierer-Krankenhäuser aufgrund der Absenkung ihrer Vergütungen freiwillig aus dem ‚Markt‘ ausscheiden.“
Zusätzlich unter Druck geraten die Kliniken durch Kürzungen der Bundesländer. Diese sind zur Finanzierung von Baumaßnahmen verpflichtet, während die Zahlungen der Krankenkassen den laufenden Betrieb sichern sollen („duale Finanzierung“). De facto kommen die Länder ihrer gesetzlichen Verpflichtung aber nicht nach. Schon seit vielen Jahren wird der jährliche Investitionsbedarf von 6 Milliarden Euro, der nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft für Erhalt und Modernisierung bestehender Klinikgebäude nötig ist, nur etwa zur Hälfte gedeckt. In der Folge werden Mittel, die eigentlich für Personal und Krankenversorgung gedacht sind, in Bauprojekte umgeleitet. Der Druck auf die Personalbudgets verschärft sich.
Zugleich erzeugt das DRG-System einen permanenten Rationalisierungsdruck. Krankenhäuser, deren Ausgaben über den Fallpauschalen liegen, sind bei Strafe des Untergangs dazu gezwungen, ihre Kosten zu senken. Tun sie das jedoch, sinken auch die Durchschnittswerte, an denen sich die DRGs orientieren – und in der Konsequenz die Pauschalen. Auch Kliniken, die (noch) schwarze Zahlen schreiben, werden so zur ständigen „Optimierung“ ihrer Kostenstruktur veranlasst.
Neben Ausgabenkürzungen haben Klinikmanager die Möglichkeit, die wirtschaftliche Situation durch die Steigerung der Einnahmen zu verbessern. Sprich: Es müssen mehr lukrative „Fälle“ generiert werden, auch wenn das medizinisch vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Dieser ökonomische Anreiz dürfte eine zentrale Ursache dafür sein, dass in keinem anderen OECD-Land so viele Herzkatheter und künstliche Hüften eingesetzt und Brustoperationen durchgeführt werden wie in Deutschland.
Doch die Beschäftigungsentwicklung hält mit der Zunahme der Behandlungsfälle bei Weitem nicht Schritt. Stattdessen ging die Zahl der Pflegekräfte im Zuge der DRG-Einführung zunächst um mehrere Zehntausend zurück. Infolge diverser Sonderprogramme – die vor allem aufgrund des Drucks gewerkschaftlicher Aktionen aufgelegt wurden – hat sich die Zahl der Pflegekräfte zuletzt wieder etwas erhöht. Der eklatanten Arbeitsverdichtung sind damit aber längst noch keine Grenzen gesetzt (siehe Grafik 4).
Streiks und Proteste
Aus Sicht der Beschäftigten ist die hohe Arbeitsbelastung längst Thema Nummer eins. Viele suchen individuelle Auswege, verlassen den Beruf oder reduzieren auf eigene Kosten ihre Arbeitszeit. Doch auch die Bereitschaft, sich kollektiv zur Wehr zu setzen, nimmt zu. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde das erstmals im Jahr 2015 bewusst, als Beschäftigte des Berliner Uniklinikums Charité zwei Wochen lang die Arbeit niederlegten, um einen Tarifvertrag für Gesundheitsschutz und mehr Personal zu erzwingen. Sie machten sich dabei den Umstand zunutze, dass die Klinikleitungen aufgrund des DRG-Systems durch Streiks ökonomisch unter Druck gesetzt werden können. Die Tatsache, dass 1 200 der 3 000 Betten während des Ausstands nicht belegt werden konnten, nur Notfälle operiert und zwanzig Stationen komplett geschlossen wurden, verursachte Millionenverluste. Nachdem Versuche gescheitert waren, den Streik per Gerichtsbeschluss verbieten zu lassen, gab die Charité- Spitze schließlich nach und unterzeichnete den ersten Tarifvertrag für mehr Personal in einem deutschen Krankenhaus.
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.
Der Erfolg an der Charité motiviert Klinikbelegschaften bundesweit zum Widerstand. Im Saarland hat ver.di 21 Krankenhäuser zu Tarifverhandlungen über Entlastung aufgefordert. Über 900 Beschäftigte, vor allem Pflegekräfte, traten der Gewerkschaft bei. Mit zwei Warnstreiks bewegten sie die Uniklinik Homburg und die Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes sowie mehrere katholische Einrichtungen dazu, Verhandlungen mit ver.di aufzunehmen, die zu Redaktionsschluss noch andauerten.
Die betrieblichen und tariflichen Proteste erhöhen auch den Druck auf die Bundesregierung. Ver.di fordert eine gesetzliche Personalbemessung, die den Krankenhäusern in allen Bereichen Mindestbesetzungen vorschreibt. Zumindest einen ersten Erfolg hat die Gewerkschaft dabei nun erzielt: Laut Parlamentsbeschluss sollen Krankenkassen und Kliniken Personaluntergrenzen für besonders „pflegesensitive“ Bereiche entwickeln. Doch zum einen ist völlig unklar, was das sein soll, und zum anderen wird mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft ausgerechnet die entschiedenste Gegnerin gesetzlicher Vorgaben damit beauftragt, diese zu entwickeln. Erst wenn sich Kassen und Krankenhäuser nicht einig werden, will das Gesundheitsministerium Personaluntergrenzen ab 2019 per Verordnung einführen. Ob es dazu kommt und wie die Vorgaben dann aussehen, ist völlig ungewiss. Ver.di hat daraus den Schluss gezogen, dass in den kommenden Monaten auf betrieblicher, tariflicher und politischer Ebene weiter Druck zu machen ist. Unmittelbar fordert die Gewerkschaft die Einstellung von 20 000 zusätzlichen Pflegefachkräften, mit denen eine Entlastung im Nachtdienst und bessere Ausbildungsbedingungen erreicht werden sollen.