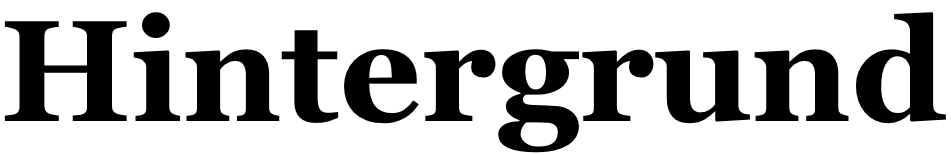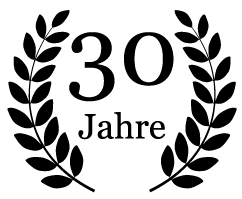„Feel the Bern“ zwingt „Chaos-Königin“ in die Abnutzungsschlacht
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Der linke Bernie Sanders eröffnet eine Friedensperspektive in den USA und macht der Demokraten-Favoritin Hillary Clinton das Leben schwer
Der US-Vorwahlkampf geht in eine neue Runde. In gleich fünf Ostküstenstaaten wird an diesem kleinen „Super Tuesday“ gewählt – Pennsylvania, Maryland, Delaware, Rhode Island und Connecticut. Bei der Partei der Demokraten liegt in den Umfragen zwar Hillary Clinton vorn, doch der linke Bernie Sanders bleibt ihr auf den Fersen. Er hat die „Mainstreet“ hinter sich gegen die Frontfrau der Wallstreet und er gibt sich allen Unkenrufen in den Miesmachermedien nicht geschlagen. Der Kandidat der Herzen kämpft und kämpft und kämpft.
Bei den Republikanern ist die Kandidatenfrage wesentlich einfacher. Milliardär Donald Trump liegt bei den bisherigen Vorwahlen deutlich vor seinen Mitbewerbern. Er hat die aggressiveren und pumpleren Sprüche und ohne Frage die schlechtere Frisur, da hilft auch kein Farbwechsel. Inhaltlich liegen zwischen ihm und den erzreaktionären Mitbewerbern allerdings keine Welten. Ted Cruz und John Kasich haben sich mittlerweile verabredet, eine Nominierung ihres Konkurrenten im Sommer zu verhindern. Bei den Vorwahlen in Indiana (3. Mai), in Oregon (17. Mai) und New Mexico (7. Juni) wollen sie nicht gegeneinander konkurrieren, sondern jeweils nur einer von ihnen gegen Trump antreten. Parteischach ersetzt hier Politik.
Bei der Kontroverse Hillary Clinton versus Bernie Sanders geht es tatsächlich um Politik. Hier stehen sich Kriegsfalke und Friedenstaube gegenüber. Hier will ein bodenständiger Senator aus Vermont seine soziale Politik auch auf Bundesebene umsetzen, da eine Millionärin mit ihrem Mann wieder ins Weiße Haus. Von seiner Konkurrentin, die für Redeauftritte gerne mal 200 000 Dollar Gage einstreicht, ist für die Masse der Bevölkerung nicht viel zu erwarten.
Die Überwindung der Ungleichheit ist das zentrale Thema Bernie Sanders. Er will eine Verdoppelung des Mindestlohns auf 15 Dollar bis zum Jahr 2020. Mit einem großen Infrastrukturprogramm der – bei vielen rechten Amerikanern verhassten – Bundesregierung will er Millionen Jobs schaffen. Die allgemeine Rentenversicherung soll aus- und eine Krankenversicherung aufgebaut werden, die allen US-Amerikanern Zugang zu umfassender Gesundheitsversorgung garantiert. Noch dazu will er den Zugang zu den Hochschulen egalisieren. Gute Bildung soll nicht mehr länger vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Reichtum soll der Gesellschaft zugute kommen, nicht mehr nur der eigenen kleinen Familie.
Eine Studie der Linkspartei-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung über „Bernie Sanders´ sozialistisches Amerika“ bringt es auf den Punkt: „Wenn er darüber spricht, wie Amerika zu einem der Länder mit der weltweit ausgeprägtesten Ungleichheit werden konnte, gilt Bernies Zorn besonders den Großbanken, die er für die Finanzkrise der Jahre 2007/2008 verantwortlich macht. Kein einziger Bankchef sei dafür ins Gefängnis gekommen, dass er Mitschuld an dem Crash trägt, während das amerikanische Strafrechtssystem andererseits Millionen Menschen für geringfügige und nicht gewalttätige Delikte zu Haftstrafen verurteilt.“ Der Zuspruch für Bernie Sanders von Millionen, „Feel the Bern“ wie die Euphorie Hashtag-tauglich gebündelt wird, liege daran, schreibt Ethan Earle, dass er so unverblümt ausspricht, wie es um das Land stehe. „Die Verschuldung der Privathaushalte und die wirtschaftliche Ungleichheit haben historische Ausmaße erreicht, und die Generation, die jetzt ins Erwachsenenalter kommt, wurde durch den Irak-Krieg und die Große Rezession sozialisiert.“ Bernie Sanders beschreibe das System als „kaputt, und zwar irreparabel kaputt“.
Der Unterschied zu Hillary Clinton? Letztere repräsentiert viel zu viel von dem, was am politischen System in den USA heute „dysfunktional“ sei, als dass sie jenseits von Wahlkampfrhetorik tatsächliche Abhilfe schaffen könnte (und wollte), so die RLS-Studie. „Sie ist der Wall Street so eng verbunden wie nur irgendein Politiker gleich welcher Partei. Sie hat für den Irak-Krieg gestimmt und hält dem kriegerischen Falkenflügel einer Demokratischen Partei die Treue, der von der weithin diskreditierten Fahne des liberalen Interventionismus um keinen Preis lassen mag.“ Clinton sei politisch vor allem darauf „geeicht“, Macht als solche zu gewinnen, während Sanders über 30 Jahre hindurch in verschiedenen Wahlämtern „konsequent zu seinen Wertmaßstäben gestanden hat“. Mit Hillary Clinton eine Frau ins Weiße Haus zu wählen, wäre ein Akt von hohem Symbolgehalt, doch die Notwendigkeit, das Land „substanziell zu verändern, wiegt bedeutend schwerer“.
Nachgerade vernichtend im Urteil ist das herausragende Buch der Journalistin Diana Johnstone „Die Chaos-Königin. Hillary Clinton und die Außenpolitik der selbsternannten Weltmacht“. Der Glaube, der Wunsch oder die Hoffnung, mit der Demokraten-Kandidatin ziehe im Zweifelsfall gegenüber dem „Exzentriker Donald Trump“ am Ende das „kleinere Übel“ ins Oval Office, werden auf 290 Seiten ein für alle mal zerstört. Hillary Clinton verkörpere den „Konsens zwischen den Neokonservativen und den liberalen humanitären Interventionisten, der das außenpolitische Establishment in Washington dominiert“, lautet die Warnung gleich zu Beginn des Vorworts der deutschen Ausgabe. Sie repräsentiere „den aggressivsten Flügel der Kriegspartei innerhalb des politischen Establishments der USA“ und praktiziere Außenpolitik „im Stil einer persönlichen Vendetta“. Hillary Clinton habe ganz klar die Absicht, schreibt Johnstone, „die Politik des ‚Regimewandels’, die sie als Außenministerin verfolgte, weiterzubetreiben. Sie war eine der Hauptanstifterinnen des Krieges zum Sturz von Gaddafi in Libyen und immer eine der entschiedensten Verfechterinnen des Einsatzes aller notwendigen Mittel, um Baschar al-Assad in Syrien zu stürzen.“ Das entstandene Chaos habe ihren Eifer keineswegs gemindert. En detail legt die Autorin dar, welch „führende Rolle“ Hillary Clinton „bei der Zerstörung Libyens als lebensfähiger Staat“ gespielt hat.
Hillary Clinton ist die „Lieblingskandidatin der Kriegspartei“ geworden, ist sich Diana Johnstone sicher. Akribisch führt sie die Liste der Sponsoren der möglicherweise ersten Frau auf dem Posten des Commander in Chief, des allmächtigen Oberkommandieren über alle US-Truppen. Zu den Spendern der Clinton-Stiftung „im zweistelligen Millionenbereich“ gehören demnach „Saudi-Arabien, der proisraelische Oligarch Viktor Pintschuk und die Saban-Familie, zu den Spendern im einstelligen Millionenbereich Kuwait, ExxonMobil, die ‚Freunde Saudi-Arabiens’, James Murdoch, Katar Boeing, Dow Chemical Company, Goldman Sachs, Walmart und die Vereinigten Arabischen Emirate“. Dann gebe es noch die „Geizhälze wie die Bank of America, Chevron, Monsanto, Citigroup und die unvermeidliche Soros-Stiftung, die lediglich Beträge im Bereich von etwa einer halben Million Dollar gespendet haben“.
Die „Kriegspartei“ habe das Zweiparteiensystem fest im Griff. Die Präsidentschaftswahlen seien „ein großes Unterhaltungsdrama“. Das intellektuelle Niveau des Streits zwischen Republikanern und Demokraten erinnere „immer mehr an das der Zirkuswettrennen mit grünen Streitwagen auf der einen und blauen Streitwagen auf der anderen Seite, die das Byzantinische Reich spalteten“, schlussfolgert Diana Johnstone. Ihr Ausblick auf den Herbst: „Da die Kriegspartei beide Zweige des Zweiparteiensystems dominiert, lässt die Erfahrung der letzten Jahre darauf schließen, dass die Republikaner einen Kandidaten nominieren, der so schlimm ist, dass Hillary Clinton sich neben ihm gut ausmacht.“
Der Aufstieg der „Chaos-Königin“ sollte klarmachen, dass das Festhalten an der Demokratischen Partei als „kleinerem Übel“ „total gescheitert“ sei. Es sei sicher, so die Autorin, dass zahllose US-Amerikaner Gegner der Kriegspartei sind – „und zwar wesentlich mehr, als dem Pro-Kriegs-Establishment klar ist“, so Johnstone.
Ihre Mahnung an Bernie Sanders: Selbst der aufrichtigste Friedenskandidat brauche ein „Friedensteam“, mit dem er bei seinem Machtantritt die Kriegspartei im Weißen Haus und im Außenministerium ersetzen könne. Trotz seiner „Fensterreden“ habe Barack Obama kein Friedensteam gehabt und seine Macht daher derselben alten Kriegspartei überlassen.
Diana Johnstone macht auch konkrete Vorschläge für ein solches Zukunftskabinett: „Um nur einige zu nennen, könnten wir mit Stephen Cohen als Botschafter in Moskau beginnen, unterstützt im Außenministerium von John Mearsheimer, Stephen Walt, Chas Freeman und vielen anderen. Ron Paul wäre ein ausgezeichneter Verteidigungsminister, der seinen eigenen Haushalt kürzt. Dennis Kucinich könnte ein neues Ministerium für den Übergang zum Frieden leiten, das nach Möglichkeit zur Förderung friedlicher Beziehungen im Äußeren und einer Kultur des Friedens im Inneren forschen würde (…). Cynthia McKinney sollte die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen sein. Die ehemalige FBI-Whistleblowerin Coleen Rowley ist sehr gut zur Beaufsichtigung der Sicherheitsdienste qualifiziert. William R. Pol, Familiennachkomme des elften Präsidenten der USA, wäre ein guter Nationaler Sicherheitsberater des neuen Präsidenten dieser Traum-Administration.“
Doch Diana Johnstone ist kein Träumerin oder Traumtänzerin. Sie weiß, „keiner dieser anständigen Menschen würde je von einem Senat bestätigt, dessen Mitglieder nicht nur alle den Wahlkampfspenden des AIPAC und verschiedener anderer, mit der Militärindustrie verbundener Lobbys verpflichtet sind, sondern mittlerweile auch selbst weitgehend an das Geschwätz glauben, das sie seit Jahren in den großen Zeitungen lesen“.
Ein Friedenskandidat der letzten Minute wäre eine wunderbare Überraschung, schwärmt die Autorin. Doch eine echte Alternative müsse langfristig aufgebaut werden. „Eine Friedenspartei muss unparteiisch und überparteilich sein und alle Menschen zusammenführen, die von der gemeinsamen Kriegspartei der Neokonservativen und der humanitären Heuchler die Nase voll haben. Sie alle können sehr verschiedene innenpolitische Ansichten haben, aber trotzdem begreifen, dass Krieg eine Frage von Leben und Tod ist.“
In diesem Sinne bleibt, mit Bernie Sanders zu fiebern. Ihm und seinen unermüdlichen Unterstützern ist zu verdanken, dass der Vorwahlkampf für Hillary Clinton kein Triumphzug ist, sondern eine „politische Abnutzungsschlacht“ (Handelsblatt). Am Ende zieht sie bestenfalls als „kleineres Übel“ ins Weiße Haus, keinesfalls als Hoffnungsträgerin. Der 74-Jährige eröffnet dagegen gerade eine echte Zukunftsperspektive.
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.
Leseempfehlung des Autors:
Diana Johnstone: Die Chaos-Königin. Hillary Clinton und die Außenpolitik der selbsternannten Weltmacht. Westend-Verlag, Frankfurt am Main, 290 Seiten, 19,99 Euro