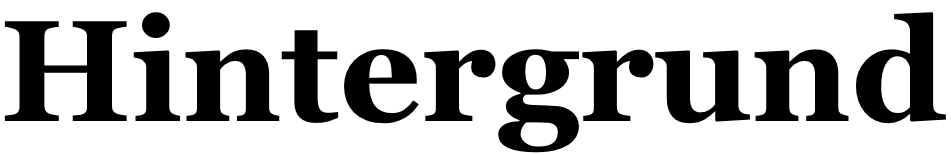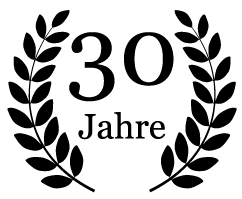Smarter Klassenkampf von oben
„Digitale Revolution“: Wie vermeintliche technologische Sachzwänge zur ideologischen Folie für neoliberale Reformen werden
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Nehmen uns Roboter die Arbeitsplätze weg? Oder entlasten sie uns von stumpfsinniger Monotonie, schaffen Raum für mehr kreative Tätigkeiten und kürzere Arbeitszeiten? Das Meinungsbild in der Bevölkerung ist jedenfalls eindeutig, glaubt man einer Mitte März veröffentlichten Umfrage des Forschungsministeriums: Weit mehr Menschen erwarten von der „Digitalisierung“ negative Veränderungen, nur eine Minderheit blickt optimistisch in die Zukunft. 60 Prozent rechnen damit, dass die Mehrheit der Menschen im Jahr 2030 nicht mehr in einem Anstellungsverhältnis arbeitet, sondern als De-facto-Selbstständige für viele unterschiedliche Auftraggeber, 84 Prozent befürchten eine weitere Vergrößerung der Einkommensunterschiede.
Nun ist Digitalisierung, wie wir das Wort heute verwenden, ein relativ junger Begriff, aber kein Phänomen, das plötzlich über uns hereingebrochen ist – im Gegenteil: Der massenhafte Einsatz digitaler Technologie in Produktion, Entwicklung und Verwaltung reicht in den USA und Japan mindestens bis in die 1970er, in Europa bis in die 1980er Jahre zurück. Vielleicht wäre es sinnvoller, die „digitale Revolution“ als langfristigen Umwälzungsprozess zu betrachten, der sich in sukzessiven „Innovationsschüben“ vollzieht. So gesehen könnte man das verbreitete Unbehagen angesichts der aktuellen Digitalisierungswelle auch als Resonanz jahrzehntelanger kollektiver Erfahrungen begreifen. Nicht erst seit der Erfindung von Internet, Mobilfunk und „Big Data“ ist die real stattfindende Digitalisierung der Arbeitswelt ein gigantisches Rationalisierungsprogramm. Wer ihm ausgesetzt ist, versteht auch ohne Expertenbeistand, dass der Prozess nicht in einem herrschaftsfreien Raum abläuft, sondern unter kapitalistischen Bedingungen, in denen die Machtressourcen sehr ungleich verteilt sind. Sowohl die Richtung der technologischen Entwicklung als auch die Art und Weise, wie die neuen Technologien in den Arbeitsprozess integriert werden, werden weitgehend durch strategische Unternehmensentscheidungen und das Direktionsrecht des Arbeitgebers bestimmt.
Längst durchdringt die „digitale Revolution“ den Alltag von Millionen Beschäftigten. Und deren Alltagserfahrung deckt sich nicht unbedingt mit dem von Unternehmern – und in abgeschwächter Form auch von der Bundesregierung – inszenierten Bild, das vor allem neue, individuelle Freiheitschancen in den Vordergrund stellt. Für sie ist Digitalisierung vielfach mit einer Zunahme der Arbeitsbelastung, ständiger Erreichbarkeit, wachsenden Anforderungen bei ungenügenden Qualifikationsmöglichkeiten, unzureichender Personalbemessung und einer Entgrenzung der Arbeitszeit verbunden. Vor diesem Hintergrund sind Umfrageergebnisse wie das eingangs zitierte nicht verwunderlich.
„Der starre Acht-Stunden-Tag“
Im öffentlichen Diskurs ist die „Digitalisierung“ mit einer Wolke von Schlagworten verbunden, die irgendwie zusammenhängen und sich doch nur erstaunlich selten zu einem schlüssigen Kontext verdichten: „Plattformökonomie“ und „Crowdwork“, „Industrie 4.0“ und „digitaler Kapitalismus“, „smarte Technologien“ und „autonomes Fahren“, „cyber-physische Systeme“ und „3D-Drucker“, „bedingungsloses Grundeinkommen“ und „künstliche Intelligenz“. Es macht Mühe, zu unterscheiden, was daran Marketing, was Ideologie und was Realität ist. Ein Zufall ist das nicht: Dass wir heute „in fast jeder gesellschaftlichen Sphäre von Industrie 4.0 reden, ist nicht die kausale Folge eines realen Stands technischer Entwicklungen, sondern diskursanalytisch betrachtet ein Fall professionellen agenda-buildings“, schrieb die Hohenheimer Soziologie-Professorin Sabine Pfeiffer schon vor zwei Jahren mit Blick auf einen zur Hannover Messe 2011 von Forschungs- und Industrielobbyisten erfolgreich lancierten Marketingbegriff.
Beschränkte sich das „Agenda-Building“ darauf, Forschungsgelder zu akquirieren, wäre die Angelegenheit vergleichsweise harmlos. Doch es geht um mehr, nämlich um langfristig wirksame gesellschaftspolitische Weichenstellungen. Quasi ergänzend zum „Industrie 4.0“-Diskurs protegierte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Anfang 2015 die Idee vom „Arbeiten 4.0“. Es gehe darum, „einen Blick in die Arbeitswelt von heute, aber auch von morgen und übermorgen“ zu werfen, schrieb Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in einem
„Grünbuch“, das „einen breiten Dialog darüber in Gang setzen“ sollte, „wie wir arbeiten wollen und welche Gestaltungschancen es für Unternehmen, Beschäftigte, Sozialpartner und Politik gibt“. 3 Ziel des Prozesses sollte es sein, „einen neuen sozialen Kompromiss (…) zwischen den Flexibilitätsanforderungen der Unternehmen und den Bedürfnissen der Beschäftigten“ zu entwickeln.
Anderthalb Jahre später, Ende 2016, legte das BMAS mit seinem „Weißbuch Arbeiten 4.0“ das Ergebnis des „Dialoges“ vor. Der darin präsentierte „neue gesellschaftliche Flexibilitätskompromiss“ beinhaltet neben den bekannten Leitbildphrasen über künftige Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und neue Freiheiten für die „Work-Life-Balance“ der Beschäftigten eine sehr konkrete gesetzgeberische Agenda: Noch vor der Sommerpause will die Koalition eine „Öffnung“ des Arbeitszeitgesetzes beschließen. Durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen sollen – zunächst für eine dreijährige „Experimentierphase“ – die Schutzstandards des Gesetzes unterlaufen werden können.
Was Nahles einen Kompromiss nennt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Konzession an andauernde Forderungen der Unternehmerschaft. „Der starre Acht-Stunden-Tag passt nicht mehr ins digitale Zeitalter, wir wollen mehr Beweglichkeit“, hatte Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), im Dezember 2015 erklärt. Tatsächlich geht es nicht um den Angriff auf den Acht-Stunden-Tag, wie der Arbeitszeitexperte Andreas Hoff in einer aktuellen Studie aufzeigt – vielmehr geht es darum, die Zehn-Stunden-Obergrenze zu schleifen. Nach den Vorstellungen der Unternehmer würde künftig nur noch ein wöchentliches Limit von 48 Stunden gelten. Darüber hinaus soll die vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen abgeschafft oder zumindest aufgeweicht werden. Hoff weist in seiner Studie außerdem nach, dass selbst mit der heutigen Rechtslage, die zahlreiche Ausnahmeregelungen zulässt, tägliche Arbeitszeiten von 12, 13 Stunden möglich und keine Seltenheit sind.
Technologisch notwendig?
Auch wenn das BMAS die Vorschläge der BDA nicht übernimmt, folgt es im Wesentlichen doch deren argumentativer Logik: Die „digitale Revolution“ macht eine weitere Flexibilisierung des Arbeitszeitregimes notwendig. Da fällt kaum auf, dass die vermeintlichen technischen Sachzwänge nirgends schlüssig begründet, sondern einfach als Selbstverständlichkeit in den Raum gestellt werden.
Nun gibt es tatsächlich technologische oder prozesstechnische Gründe für Abweichungen vom Normalarbeitstag. Sie sind auch kein neues Phänomen: Damit er morgens frische Brötchen verkaufen kann, muss der Bäcker nachts in der Backstube stehen. Hochöfen im Stahlwerk dürfen während des kompletten Verhüttungsvorganges nicht erlöschen und müssen über mehrere Tage rund um die Uhr mit Erz und Koks beschickt werden, was ohne Schichtbetrieb nicht zu machen ist. Doch es ist nicht erkennbar, warum der Einsatz von Bürocomputern, Internet, mobilen Endgeräten, RFID-Chips oder 3D-Druckern etwas Vergleichbares erfordern würde. Die Motive zur Flexibilisierung und Verlängerung von Arbeitszeiten im Zuge der Digitalisierung sind gerade nicht technischer, sondern betriebswirtschaftlicher Natur: Damit sich die hohen Investitionen rechnen, sollen teure Maschinen und Anlagen möglichst lange laufen.
Referenzmodell Bosch
„Nicht immer entspricht das Korsett des Arbeitszeitrechts den spezifischen Bedürfnissen bestimmter Betriebe oder Beschäftigter“, so Ministerin Nahles in einem Gastbeitrag für die FAZ am 21. Juni 2016. „Hier könnte der gesetzliche Rahmen etwas erweitert werden, unter der Voraussetzung ‚ausgehandelter Flexibilität‘, die einen Tarifvertrag und eine Betriebsvereinbarung voraussetzt.“ Im anderthalb Jahre später veröffentlichten „Weißbuch“ heißt es nun, man wolle künftig „ein Mehr an Regelungsmöglichkeiten an das Bestehen von Tarifverträgen knüpfen“.
Als Referenzmodell wird dabei eine Konzernbetriebsvereinbarung von Bosch zur Mobilarbeit angeführt. Hier ist seit 2014 geregelt, dass Beschäftigte, deren Arbeitsaufgabe dies sachlich zulässt, einen Rechtsanspruch haben, gelegentlich zu Hause zu arbeiten. Diese Mobilarbeit ist grundsätzlich freiwillig und kann nicht angeordnet werden. Beschäftigte entscheiden, wann sie erreichbar sind, und hinterlassen die Zeiten im Büro. Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist verboten. Die Arbeitszeiten werden durch die Beschäftigten selbstständig erfasst und als normale Arbeitszeit vergütet. Zuschläge für genehmigungspflichtige Mehrarbeit werden bezahlt, nicht aber für Spät- oder Nachtschichten, sofern diese nicht explizit angeordnet werden.
Offenbar kommt die Regelung bei den Beschäftigten gut an, während sie für viele Führungskräfte eher gewöhnungsbedürftig ist. Man kann sie durchaus als Beispiel für eine gelungene betriebliche Regelung diskutieren, aus der sich lernen lässt. Ob sie als Blaupause für neue gesetzliche Standards dienen kann, steht auf einem anderen Blatt. Was im baden-württembergischen Technologiekonzern mit seiner hohen tariflichen Absicherung, ausgeprägten Mitbestimmungstradition und gewerkschaftlich gut organisierten Belegschaft funktioniert, kann andernorts, wo Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung längst fragil geworden sind, wo Gewerkschaften schwach und Betriebsräte allenfalls Erfüllungsgehilfen von Geschäftsführungen sind, einen Dammbruch bei elementaren Schutzbestimmungen auslösen. Wenngleich gewiss nicht so intendiert, ist genau dieser Effekt typisch für die Reformen der aktuellen Bundesarbeitsministerin: Gesetzliche Schutzrechte für Beschäftigte durch Tarifverträge prinzipiell aushebelbar zu machen und das dann auch noch als Stärkung von Tarifautonomie und Mitbestimmung zu verkaufen, ist gewissermaßen zu einem Markenzeichen von Andrea Nahles geworden.
Gewerkschaften unentschieden
Die Positionen der Gewerkschaften zur Agenda des BMAS sind ambivalent. Tenor ist allgemein, dass Aufweichungen des Arbeitszeitrechtes zurückgewiesen werden. Argumentativ wird dabei ins Feld geführt, dass „der Arbeitsmarkt in Deutschland bereits in hohem Maße von flexiblen Arbeitszeiten geprägt ist“, dies den Beschäftigten aber in der Regel nicht mehr Arbeitszeitsouveränität, sondern eine Zunahme atypischer Arbeitszeiten gebracht habe. 11 Zugleich wird der durch das BMAS initiierte „Dialog“ grundsätzlich begrüßt. 12 Erkennbar sind die heterogenen Interessenlagen unterschiedlicher Gewerkschaften: In den gut organisierten und mitbestimmungsgeprägten Kernbereichen der IG Metall (siehe Bosch) kann man mit den angestrebten Änderungen besser leben als im von Prekarität und Niedriglöhnen betroffenen privaten Dienstleistungssektor (ver.di).
Auffällig ist, dass die naheliegendste Konsequenz aus der Digitalisierung – das Potenzial für eine deutliche Arbeitszeitverkürzung – kaum thematisiert wird. War Arbeitszeitverkürzung in den 1980er Jahren noch die gewerkschaftliche Antwort schlechthin auf die beginnende Digitalisierung, ist das Thema inzwischen weitgehend tabuisiert. „Eine Soundsoviel-Stunden-Woche ist heute für alle Beteiligten nicht mehr das Thema“, konnte die Arbeitsministerin bei der Vorstellung des „Weißbuches“ konstatieren, ohne Widerspruch befürchten zu müssen.
Dennoch gibt es sowohl bei ver.di als auch bei der IG Metall Ansätze einer eigenen arbeitszeitpolitischen Offensive, was nach vielen Jahren Sprachlosigkeit auf diesem Gebiet ein Novum ist und vor dem Hintergrund der oben geschilderten historischen Traumatisierungen gar nicht hoch genug bewertet werden kann. So startete die IG Metall im Sommer 2016 ihre Kampagne „Mein Leben – meine Zeit“. Erstmals seit 2004 wird hier das Thema Arbeitszeit wieder systematisch in Form einer breit angelegten Kampagne aufgegriffen. Als Kernziele formuliert die Organisation darin etwa, unbezahlter Mehrarbeit ein Ende zu setzen und den „Verfall“ geleisteter Arbeitszeit aufzuhalten. Für den Bereich der Mobil- oder Heimarbeit fordert die Organisation einen Rechtsanspruch der Beschäftigten, den der Arbeitgeber nur in begründeten Fällen ablehnen kann; Arbeitszeit soll dabei grundsätzlich erfasst und regulär bezahlt werden. Zugleich will die IG Metall, dass niemand gegen seinen Willen zur Mobilarbeit verpflichtet werden kann und Beschäftigte grundsätzlich ein „Recht auf Nichterreichbarkeit“ haben.
Etwa zeitgleich hat ver.di die arbeitszeitpolitische Debatte wieder aufgenommen, auch wenn dort noch keine Kampagne in Sicht ist. Im Jahr 2015 hat die Tarifpolitische Grundsatzabteilung ein Konzept für eine künftige ver.di-Arbeitszeitpolitik vorgelegt. So wie die Beschäftigtenstruktur im ver.di-Organisationsbereich eine andere ist als bei der IG Metall, setzt das Papier auch andere Akzente. Kernforderung ist die nach einer zusätzlichen „Verfügungszeit“ von 14 freien Tagen, die jeder Beschäftigte im Jahr bekommen soll. Diese Forderung soll für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte gleichermaßen attraktiv und mobilisierungsfähig sein. In Verbindung mit der Idee der Verfügungszeit wird das Leitbild einer „kurzen Vollzeit“ ins Spiel gebracht – eine Formulierung, die sich auch im Kontext der IG Metall in letzter Zeit häufiger findet.
Eine vielversprechende Strategie, ursprünglich von ver.di, ist inzwischen auch in der IG-Metall-Kampagne aufgegriffen worden: die Verknüpfung von Arbeitszeit, Arbeitsverdichtung und Personalbemessung. Im Frühjahr 2016 konnte ver.di am Berliner Universitätsklinikum Charité den bundesweit ersten Tarifvertrag zur Personalmindestbesetzung im Gesundheitswesen durchsetzen. Vorausgegangen war ein jahrelanger Kampf der Charité-Beschäftigten. Bemerkenswert ist auch, dass die Initiative von den gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten ausging und von der ver.di-Führung lange Zeit nicht unterstützt wurde. Am Ende war sie trotzdem erfolgreich.
Auch die Linke im Bundestag meldete sich im Juni 2016 mit einem Positionspapier zum „Arbeiten 4.0“-Prozess. Die „Digitalisierung“ werde „als Hebel angesetzt, um vor dem Hintergrund eines neuen Rationalisierungsprozesses eine umfangreiche Deregulierung von Arbeitnehmer*innenrechten durchzusetzen“, heißt es im analytischen Teil. Damit sich der technologische Fortschritt aber tatsächlich auch zum Vorteil der Beschäftigten auswirken könne, seien „konsequente Regulierungen auf gesetzlicher Ebene unabdingbar“. Als einzige politische Partei will die Linke eine Reduzierung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit, ein gesetzliches Recht auf Nichterreichbarkeit und eine Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Lage und Verteilung der Arbeitszeit sowie der Personalausstattung. Schließlich fordert die Partei eine „effektive Anti-Stress-Verordnung als Bremse gegen Dauerstress, Burn-Out und Arbeit auf Abruf“.
Bei all diesen Initiativen sind Schnittmengen unverkennbar. Sinnvoll wäre es, die Diskussion überall dort zu befördern, wo sich in den kommenden Jahren die reale Auseinandersetzung um die Neugestaltung des Arbeitszeitregimes entfalten wird. Entscheidend wird am Ende sein, ob gewerkschaftliche und linke Arbeitszeitforderungen eine Bewegungsdynamik entfalten können – oder ob sie nur eine Randnotiz zur professionell inszenierten Simulation eines gesellschaftlichen Dialoges bleiben werden.