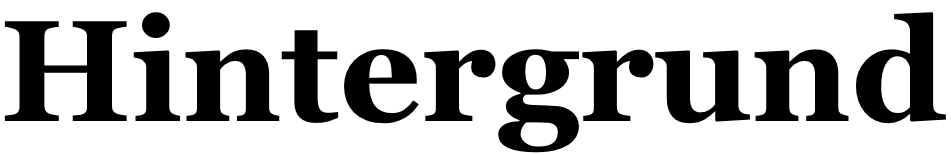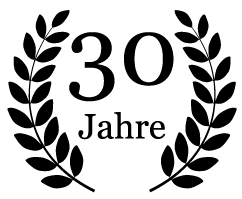Placebos gegen Wohnungsnot
Weder „Mietpreisbremse“ noch „Neubauoffensive“ verhindern Verdrängung und explodierende Mieten
Hinweis: Die Bilder sind aus den archivierten Hintergrund-Texten vor 2022 automatisch entfernt worden.
Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum nimmt für weite Bevölkerungsteile zunehmend dramatische Formen an. In vielen Groß- und Universitätsstädten und Ballungsräumen ist es für Gering- und Normalverdiener kaum noch möglich, eine adäquate Wohnung zu einem erschwinglichen Preis zu finden. Im Gegenteil: Durch stetige Mieterhöhungen, aber besonders durch kostentreibende Modernisierungen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen werden viele Menschen aus ihren angestammten Wohnungen regelrecht verdrängt.
Das System des sozialen Wohnungsbaus, das durch Belegungsbindung und subventionierte Mieten Menschen mit geringem
Einkommen eine angemessene Wohnung sichern sollte, galt mit dem Siegeszug des neoliberalen Mainstreams in den 1990er Jahren als Auslaufmodell. Die Neubautätigkeit in diesem Segment wurde weitgehend eingestellt. Und da dieses System nicht auf der Schaffung von dauerhaft günstigem Wohnraum, sondern auf temporären Preis- und Belegungsbindungen (in der Regel zwanzig bis dreißig Jahre) basiert, ist die Zahl der Sozialwohnungen seit 1990 dramatisch zurückgegangen: von rund 3 auf 1,5 Millionen im vergangenen Jahr. Dieser Altbestand wird auch künftig um 40 000 bis 50 000 Wohnungen pro Jahr sinken. Hinzu kam eine riesige Privatisierungswelle von Wohnbeständen aus Bundes-, Landes- und Kommunalbesitz; sie wurden an private Investoren veräußert. Bekannte Beispiele sind der Verkauf von 114 000 Eisenbahnerwohnungen an ein deutsch-japanisches Finanzkonsortium im Jahr 2000 sowie der Verkauf der landeseigenen Berliner Wohnungsbaugesellschaft GSW mit 66 000 Wohnungen an die Finanzinvestoren Cerberus und Whitehall (Goldman Sachs) im Jahr 2004. Für letztere Transaktion sowie weitere Verkäufe kommunaler Wohnungsbestände zeichnete ausgerechnet ein „rot-roter“ Senat in Berlin verantwortlich, was von der PDS (heute Die LINKE), die seinerzeit unter anderem den Wirtschaftssenator stellte, mit der Schuldenlast Berlins und der entsprechend „angespannten Haushaltslage“ gerechtfertigt wurde und teilweise immer noch wird. Auch in Dresden stimmte die Mehrheit der PDS-Stadtratsfraktion im Jahr 2006 dem Komplettverkauf des städtischen Wohnungsbestandes an die US-amerikanische „Heuschrecke“ Fortress zu.
Die marktorientierte Liegenschaftspolitik, also die Vergabe von landes- und bundeseigenen Baugrundstücken an Investoren nach dem Höchstpreisprinzip, führte außerdem dazu, dass fast nur noch profitorientierte Immobilienunternehmen beim Neubau zum Zuge kamen. Ohnehin war die Wohnungsgemeinnützigkeit als Instrument zur Schaffung von dauerhaft preiswertem Wohnraum bereits im Jahr 1990 vom Bundestag abgeschafft worden.
Stetiger Abbau von Mieterrechten
Zusätzlich wurde der Druck auf Mieter durch zahlreiche Reformen des Mietrechts und eine darauf basierende Rechtsprechung verschärft. Die Möglichkeiten zur Kündigung von Mietverträgen wegen Eigenbedarfs und „mangelnder wirtschaftlicher Verwertbarkeit“ wurden beträchtlich ausgeweitert. Vor allem das im Frühjahr 2013 in Kraft getretene Mietrechtsänderungsgesetz für energetische Modernisierungen eröffnete Hauseigentümern völlig neue Möglichkeiten. Durch – oftmals nur vermeintliche – Maßnahmen der Gebäudesanierung zur Energieeinsparung können exorbitante Mietsteigerungen verlangt werden, ohne dass sich Mieter dagegen wehren können. So wurde für diese Modernisierungsart die „Härtefallklausel“, die Preiserhöhungen in einigen Fällen kappt, wenn sie für den Mieter unzumutbar sind, außer Kraft gesetzt. Besonders in begehrten Innenstadtlagen löste diese neue Gesetzeslage eine regelrechte Verdrängungswelle aus. Mieterhöhungen um 100 und mehr Prozent blieben keine Einzelfälle. Die Möglichkeit, Altmieter loszuwerden, erwies sich als äußerst lukrativ, da die Bestandsmieten (ohne Modernisierungsumlagen) zwar in den meisten Städten an den örtlichen Mietspiegel gekoppelt sind, es für Neuverträge aber so gut wie keine Restriktionen in Bezug auf die Höhe der Kaltmiete gab. Hinzu kommt, dass die neuen Mieten anschließend in die Berechnung des künftigen Mietspiegels einfließen, was diesen regelmäßig beträchtlich in die Höhe treibt. Des Weiteren wurden Kündigungen und Räumungen bei Zahlungsverzug erleichtert.
Tickende soziale Zeitbombe
Allmählich erkannten die herrschenden Parteien, dass in der Wohnungspolitik eine soziale Zeitbombe tickt. Die CDU musste registrieren, dass das starre Festhalten an marktliberalen Dogmen besonders in Großstädten und Ballungsräumen zu erheblichen Akzeptanzverlusten bei den Wählern führt. Und so nahm die Mieten- und Wohnungspolitik im Bundestagswahlkampf 2013 einen relativ großen Stellenwert ein. Sogar die CDU versprach nun eine „Neubauoffensive“, eine Wiederankurbelung der sozialen Wohnraumförderung und in der Endphase des Wahlkampfes gar eine „Mietpreisbremse“. Für Mieterhöhungen bei Neuvermietungen sollte eine Kappungsgrenze eingeführt werden, was im Wirtschaftsflügel der Partei und besonders bei den Immobilienverbänden Entsetzen und Empörung auslöste.
Das spiegelte sich auch im Koalitionsvertrag zwischen CDU und CSU nach der Wahl wider. Dort heißt es zum Thema Mieten und Wohnen unter anderem:
„Dem weiter wachsenden Wohnungsbedarf in den Ballungszentren und vielen Groß- und Hochschulstädten, dem notwendigen energetischen Umbau sowie den demografischen und sozialen Herausforderungen muss entsprochen werden. Dazu setzen wir auf einen wohnungspolitischen Dreiklang aus einer Stärkung der Investitionstätigkeit, einer Wiederbelebung des Sozialen Wohnungsbaus und einer ausgewogenen mietrechtlichen und sozialpolitischen Flankierung. (…) Damit Wohnraum insbesondere in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten bezahlbar bleibt, räumen wir den Ländern für die Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit ein, in Gebieten mit nachgewiesenen angespannten
Wohnungsmärkten bei Wiedervermietung von Wohnraum die Mieterhöhungsmöglichkeiten auf maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete zu beschränken. (…) Künftig sollen (pro Jahr, d. Verf.) nur noch höchstens 10 Prozent längstens bis zur Amortisation der Modernisierungskosten einer Modernisierung auf die Miete umgelegt werden dürfen. Durch eine Anpassung der Härtefallklausel im Mietrecht (§ 559 Abs. 4 BGB) werden wir einen wirksamen Schutz der Mieter vor finanzieller Überforderung bei Sanierungen gewährleisten.“
Wirkungslose Mietpreisbremse
Doch die Sorgenfalten in den Chefetagen der Immobilienbranche glätteten sich bald wieder. Die vollmundig angekündigte „Mietpreisbremse“ für Neuvermietungen wurde zu einem lächerlichen Konstrukt, das bis zum heutigen Tag keinerlei Wirkung zeigt. Mieten, die im Vergleich zum Mietspiegel bereits deutlich überhöht waren, wurden von der Kappungsgrenze (10 Prozent oberhalb des Mietspiegelwertes) ebenso ausgenommen wie Neuvermietungen nach „umfangreichen Modernisierungen“. Dieser Terminus erwies sich in der Rechtsprechung zudem als äußerst dehnbar. Neubauten sind von den Preisrestriktionen ohnehin generell nicht betroffen.
Noch gravierender ist jedoch die Beachtung beziehungsweise Nichtbeachtung des Gesetzes. Ein Vermieter ist danach nicht verpflichtet, dem neuen Mieter bei Vertragsabschluss die zuvor verlangte Miete mitzuteilen. Vielmehr kann sich letzterer diese Information nur auf dem Mahn- und Klageweg einholen, um eine mögliche Mietpreisüberhöhung festzustellen – ein Prozedere, das verständlicherweise kaum ein Betroffener auf sich nehmen will. Und falls es, was äußerst selten ist, doch zu entsprechenden Verfahren kommt, muss der Vermieter allenfalls die überhöhten Mietanteile ab Beginn des Verfahrens zurückzahlen und künftig auf deren Geltendmachung verzichten. Ein Ordnungs- oder Bußgeld sieht das Gesetz nicht vor. Das heißt, ein Vermieter kann vollkommen risikolos gegen das Gesetz verstoßen und jeden Preis verlangen, den der Markt hergibt.
Kommunen, Immobilienverbände und Mieterorganisationen konstatierten daher in diesem Frühjahr in seltener Einmütigkeit, dass die im Juni 2015 in Kraft getretene „Mietpreisbremse“ keinerlei dämpfende Wirkung auf die rasante Preisentwicklung bei Neuvermietungen entfaltet habe. Hinzu kommt, dass die Immobilienbranche auch ganz legale Umgehungsstrategien entwickelt hat. So werden immer mehr Wohnungen möbliert oder teilmöbliert angeboten – und das nicht nur für Kurzfristvermietungen. Die dafür verlangten Aufschläge sind gesetzlich nicht reglementiert und auch nicht in den Mietspiegeln erfasst, die die ortsübliche Vergleichsmiete abbilden. Üblich ist ein Aufpreis von 3,00 bis 3,50 Euro pro Quadratmeter auf die eigentlich zulässige Kaltmiete, bei kleineren Apartments mitunter auch deutlich mehr. Theoretisch kann das den Tatbestand des Mietwuchers erfüllen. Tatsächlich aber müssten Mieter vor Gericht nachweisen, dass bei Vertragsabschluss „eine Zwangslage, Unerfahrenheit, der Mangel an Urteilsvermögen oder eine erhebliche Willensschwäche“ ausgenutzt wurde und/oder kein angemessener Ersatzwohnraum zur Verfügung stand. Andernfalls gilt jede vereinbarte Miete als zulässig – so auch jene von „Medici Livin“, dem nach eigenen Angaben größten professionellen WG-Anbieter Deutschlands. In Berlin hat das Unternehmen mittlerweile ein breites Angebot oftmals recht einfach möbKommunenlierter, sehr kleiner Zimmer in Vier- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit gemeinschaftlicher Nutzung von Küche und Bad. Für Zimmer mit 10 bis 13 Quadratmetern werden Inklusivmieten von 430 bis 470 Euro verlangt, bei 24 Quadratmetern sind es knapp 600 Euro.
Die Mietpreisbremse erweist sich also als Papiertiger. Und die anderen im Koalitionsvertrag formulierten Ziele wurden im Laufe der Legislaturperiode klammheimlich beerdigt. Das gilt sowohl für die Begrenzung von Modernisierungsumlagen auf den Zeitraum ihrer Amortisation als auch für eine erweiterte Härtefallklausel für Mieter.
Kaum Spielraum für Länder und Kommunen
Bundesländer und Kommunen haben – außerhalb der deutlich geschrumpften Bestände der kommunalen Gesellschaften und des sozialen Wohnungsbaus – kaum Möglichkeiten, mietrechtlich in die Bestandspreise einzugreifen. Ebenfalls nur sehr begrenzte Optionen bietet der Erlass von „Milieuschutzsatzungen“ für einzelne Wohnquartiere, die eigentlich dem „Erhalt der sozialen Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“ dienen sollen. Die ursprünglich für solche Gebiete angedachten Möglichkeiten zum Erlass von Mietobergrenzen auch nach Modernisierungen sind längst durch Bundesrecht und höchstrichterliche Rechtsprechung ausgehebelt worden. Selbst für die in solchen Gebieten eigentlich vorgesehene Untersagung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen gibt es etliche Schlupflöcher. Das Instrumentarium beschränkt sich im Wesentlichen auf Restriktionen für bestimmte Luxusmodernisierungen und ein Vorkaufsrecht der Kommune bei spekulativen Verkäufen von Mietshäusern, aber auch das nur in einem sehr eng gesteckten Rahmen. Bezüglich der Mietpreispolitik kann man also konstatieren, dass die CDU/SPD-Koalition im Großen und Ganzen wenig bis gar nichts unternommen hat, um die Situation für Mieter zu verbessern.
Mehr Wohnungsbau – aber für wen?
Was die versprochene Ankurbelung des Wohnungsbaus betrifft, hat die Regierung allerdings auf den ersten Blick einiges vorzuweisen: Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen stieg von 2013 bis 2016 um 29 Prozentauf rund 277 000 Wohnungen. Um den Fehlbestand von einer Million Wohnungen
mittelfristig auszugleichen und der Nachfrage besonders in Ballungszentren und Universitätsstädten gerecht zu werden, müssten aber
mindestens 400 000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden, da sind sich Forschungsinstitute, Bundesregierung, Mieter- und Immobilienverbände weitgehend einig. Es geht allerdings nicht nur um die Quantität. Denn gebaut wurden in den vergangenen Jahren vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser sowie teure Eigentumswohnungen. Von den 2016 fertiggestellten Objekten waren lediglich 53 000 „normale“ Mietwohnungen, davon wiederum nur 24 500 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau – obwohl die Angebotslücke in diesem Segment am größten ist. Nach Schätzungen des Deutschen Mieterbundes, der als Dachverband die Mitglieder von rund 300 Mietervereinen vertritt, müsste dieser Anteil zeitnah auf 80 000 bis 100 000 Wohnungen pro Jahr erhöht werden, um eine drastische Verschärfung der Wohnungsnot in wachsenden Ballungsgebieten zu verhindern. Zwar hat der Bund seine jährlichen Aufwendungen für die soziale Wohnraumförderung zwischen 2015 und 2017 auf 1,5 Milliarden Euro verdreifacht, doch diese Mittel werden von den dafür zuständigen Ländern ganz unterschiedlich eingesetzt. So haben im Jahr 2016 Nordrhein-Westfalen und Hamburg einen Schwerpunkt auf den Bau von Sozialwohnungen gelegt, während andere Länder, wie zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg, vor allem die Eigentumsbildung von Mittelstandsfamilien gefördert haben.
Marktradikalität versus Gemeinnützigkeit
In der Debatte um die Lösung der deutschen Wohnungskrise lassen sich grob drei Lager identifizieren: Die Marktradikalen lehnen staatliche Regulierungen weitgehend ab und setzen auf die Stimulierung des Wohnungsbaus durch steuerliche Anreize. Der Markt würde sich auf diese Weise quasi von alleine beruhigen, lautet die Kernthese. Mögliche soziale Härten für finanzschwache Mieter sollen nicht durch Markteingriffe in die Preisbildung, sondern durch individuelle Alimentation in Form von Wohngeld ausgeglichen werden – was letztlich bedeutet, dass der Staat den Hausbesitzern ihre enormen Renditen finanzieren soll.
Die Verfechter der „sozialen Marktwirtschaft“, allen voran die SPD, setzen auf einen Mix aus Anreizen und sozialer Wohnraumförderung, um mittelfristig nicht nur mehr Neubau im Allgemeinen, sondern auch ein bedarfsgerechtes Segment an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen zu schaffen – aber eben nicht als Wohnraum in öffentlichem Besitz, sondern als klassische Wirtschaftsförderung mit sozial gebundener Zwischennutzung.
Auf Länderebene gehören dazu Instrumente wie die „kooperative Baulandentwicklung“, bei der die Vergabe von Grundstücken an private Investoren an ein bestimmtes Quorum von Sozialwohnungen gekoppelt wird. Die Profitlogik des Immobilienmarktes wird dabei im Kern aber ebenfalls nicht angetastet. Außerdem haben derzeit viele Investoren an Fördermitteln – wie zum Beispiel zinslosen oder zinsverbilligten Darlehen – überhaupt kein Interesse, da die Finanzierung auch großer Projekte aufgrund der seit Jahren anhaltenden Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank ohnehin extrem günstig ist. Der Run auf das „Betongold“ als Alternative zu herkömmlichen Geldanlagen hat inzwischen dazu geführt, dass selbst die mit solchen Postulaten eher vorsichtige Bundesbank vor einer Überhitzung des Marktes und der Gefahr einer „Blasenbildung“ in einigen Städten warnt. In der Tat deuten sich besonders im Hochpreissegment gewisse Sättigungsgrenzen an, und die für die Amortisation kalkulierten Verkaufs- oder Vermietungspreise sind nicht mehr in jedem Falle realisierbar.
Die dritte Gruppe, zu der auch große Teile der Partei Die LINKE gehören, will den Schwerpunkt hingegen auf gemeinwirtschaftliche Instrumente setzen, stellt aber das Privateigentum an Immobilien auch im Mietwohnungssektor nicht prinzipiell infrage. Zu den bekanntesten Verfechtern dieses Ansatzes gehört der Berliner Stadtsoziologe Andrej Holm. Holm amtierte Anfang des Jahres für einige Wochen im neuen „rot-rot-grünen“ Berliner Senat als Staatssekretär im Stadtentwicklungsressort, bevor er nach einer aggressiven öffentlichen Kampagne wegen angeblicher Falschangaben zu seiner Tätigkeit beim Wachregiment der DDR-Staatssicherheit vor 27 Jahren schließlich „entsorgt“ wurde.
In einer Anfang Juni veröffentlichten Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung entwickelt Holm das Modell einer „neuen Gemeinnützigkeit“ als Alternative zum bisherigen Fördersystem des sozialen Wohnungsbaus. „Bis her wird versucht, die Förderbedingungen an die Markterwartungen anzupassen, anstatt die Wohnungsunternehmen so umzugestalten, dass sie den sozialen Bedarf decken“, erklärt Holm in Neues Deutschland. Durch Steuerbefreiungen, den Erlass von Grundstückskosten, zinsfreie Baudarlehen und den Verzicht auf eine Eigenkapitalverzinsung ließen sich die Kostenmieten bei Neubauten von derzeit im Durchschnitt 10,30 Euro auf 4,98 Euro pro Quadratmeter reduzieren. Zusätzlich wäre der entstehende Wohnraum auch dauerhaft für soziale Zwecke gesichert und würde nicht wie bisher nach Rückzahlung der Förderdarlehen dem „freien Markt“ übergeben.
Ausgerechnet beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), der vor allem Genossenschaften und Landesunternehmen vertritt, ist man von der Idee wenig angetan. „Ich habe den Eindruck, Andrej Holm möchte die Kommunale Wohnungsverwaltung der DDR wiederhaben“, sagt BBU-Sprecher David Eberhart. Auf diese Weise würden neue soziale Ghettos entstehen. Außerdem gebe es „erhebliche Bedenken zur Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht“. Beide Einwände weist Holm zurück. So wären zum Beispiel in Berlin 56 Prozent aller Haushalte aufgrund ihres Einkommens berechtigt, mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen in Anspruch zu nehmen; da könne man wohl kaum von sozialer Ghettoisierung sprechen. Und die besonders in Österreich und den Niederlanden erfolgreich praktizierten Formen der Wohnungsgemeinnützigkeit zeigten, dass diese auch mit dem EU-Beihilferecht vereinbar seien.
Einer anderen Gruppe geht das Gemeinnützigkeitskonzept allerdings nicht weit genug: Die 2014 im Umfeld der Berliner Mietergemeinschaft gegründete „Initiative neuer kommunaler Wohnungsbau“ (inkw) will eine Abkehr von der klassischen Wohnungsbauförderung. Stattdessen plädiert sie für einen Wohnungsneubau und dessen Bewirtschaftung in unmittelbarer Trägerschaft der öffentlichen Hand, und zwar in Form von Eigenbetrieben oder Anstalten öffentlichen Rechts. Nur so könnten Wohnungen dauerhaft der Marktlogik entzogen werden, heißt es im Positionspapier der inkw.
Das Konzept einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit wird in leicht abgewandelter Form auch von den Grünen und Teilen der SPD befürwortet, während sich die Gewerkschaften eher bedeckt halten, was allerdings nicht verwunderlich ist. Schließlich liegt eine boomende und möglichst profitable private Bau- und Immobilienwirtschaft im ureigenen Interesse vieler Mitglieder und Funktionäre von ver.di und der IG BAU. Letztere unterstützt auch die Forderung der Branche nach mehr Steuergeschenken für profitablen Wohnungsbau.
Abo oder Einzelheft hier bestellen
Seit Juli 2023 erscheint das Nachrichtenmagazin Hintergrund nach dreijähriger Pause wieder als Print-Ausgabe. Und zwar alle zwei Monate.
Lokaler Widerstand ist wichtig
Wie dem auch sei: Weder für eine neue Gemeinnützigkeit noch für einen groß angelegten kommunalen Wohnungsbau sind politische Mehrheiten in Sicht. Im Gegenteil: Eine mögliche nächste CDU/FDP-Bundesregierung würde vermutlich ein Rollback bei der sozialen Wohnraumförderung und beim Mieterschutz einläuten. Umso wichtiger ist der Kampf auf lokaler Ebene, vor allem gegen die Vertreibung aus Wohnungen durch Miethaie und Spekulanten oder die Gentrifizierung ganzer Stadtteile. Bei entsprechender Vernetzung und Mobilisierung wurden dabei durchaus schon kleine Erfolge erzielt, wie in den vergangenen Monaten in Berlin-Kreuzberg. Auch gibt es Ansätze, dass Häuser selbstorganisiert durch Mikrogenossenschaften und Organisationsformen wie das „Mietshäusersyndikat“ übernommen werden. Doch als Instrument für eine soziale Wohnraumversorgung taugen diese eher auf „alternative Mittelschichten“ zugeschnittenen, marktkonformen Modelle wohl kaum.
In ihrer Gesamtheit ist die Wohnungsfrage ein sehr dickes Brett, das es zu bohren gilt. Schließlich ist der Privatbesitz an Grund und Boden – egal ob bebaut oder unbebaut – und die entsprechende Verfügungsgewalt über dessen Verwertung einer der Grundpfeiler der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Zwar scheint die Phase der massenhaften Verschleuderung öffentlicher Liegenschaften an Spekulanten mittlerweile vorbei zu sein, doch selbst „gutwillige“ Bundesländer und Kommunen haben oftmals kaum noch Möglichkeiten, nachhaltig in das Marktgeschehen bei Neubauten einzugreifen. Unsere Rechtsordnung sieht Mietobergrenzen außerhalb der geschrumpften kommunalen Bestände und des sozialen Wohnungsbaus schlicht nicht vor. Bliebe noch die Revolution als Alternative, aber das ist ja bekanntlich nicht so einfach.